Wie man aus mieser Stimmung Profit schlägt
Überall heißt es, der deutschen Wirtschaft gehe es sehr schlecht – doch stimmt das?
Von Lene Kempe und Guido Speckmann

Kürzlich rückte Deutschland in der Rangliste der Volkswirtschaften einen Platz vor: Nach China und den USA hat es nun das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dass Deutschland Japan überholen konnte, so Kommentator*innen, liege jedoch an einem Wechselkurseffekt und der Schwäche der japanischen Währung. Der Erfolg sei insofern rein symbolisch. Im Gegenteil tut sich, verfolgt man die Medienberichterstattung, ein tiefer Abgrund vor Deutschland auf. Deutschlands einst so starke Wirtschaft schwächelt, unser Wohlstand sei in Gefahr, sagen Ökonom*innen, und malen den Teufel an die Wand.
Sind Deutschlands Tage als industrielle Supermacht gezählt?
Das titelte Anfang Februar die US-Nachrichtenagentur Bloomberg und heizte damit die aufgeregte Debatte um einen wirtschaftlichen Niedergang des Landes an. Fakt ist: Im letzten Jahr erlebte Deutschland eine Rezession, also einen Rückgang des BIP-Wachstums um 0,3 Prozent. Viele Wirtschaftsinstitute rechnen auch für 2024 mit niedrigen Zuwächsen von 0,3 bis 0,9 Prozent. Und selbst die zunächst noch optimistischere Bundesregierung senkte Mitte Februar ihre Prognose von 1,3 auf 0,2 Prozent. Die Lage der deutschen Wirtschaft sei »dramatisch schlecht«, gab sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck alarmiert.
Die mauen Prognosen sind formal gut begründet: Die Exporte, »Motor« des Wachstums in Deutschland (ak 700), sind im letzten Jahr um zwei Prozent zurückgegangen, die Wirtschaft steht unter erheblichem Transformationsdruck, soll heißen, die Industrie ist auf die Anforderungen eines »klimaneutralen« Umbaus noch immer schlecht vorbereitet. Auch bei den Investitionen in Infrastruktur und neue Technologien hängt das Land hinterher, und es fehlen Fachkräfte. Jene Branchen, die einst tragende Säulen des »Modell Deutschland« waren, die Automobil-, Maschinenbau- und Chemieindustrie, klagen schon seit Monaten über Auftrags- und Umsatzrückgänge, ebenso die Digital- und Elektroindustrie: 2023 seien die Aufträge um gut zwei Prozent zurückgegangen, insbesondere aufgrund schlechter Nachfrage aus dem Ausland.
China hat die deutsche Wirtschaft dabei gleich mehrfach »ausgebremst«: Zum einen konkurriert die Volksrepublik äußerst erfolgreich mit Deutschland um Weltmarktanteile bei Autos und Maschinen oder im Chemiebereich. Zugleich schwächelt die chinesische Wirtschaft, nicht zuletzt aufgrund der dortigen Immobilienkrise. Weil China für viele deutsche Unternehmen nicht nur ein wichtiger Produktionsstandort, sondern auch Absatzmarkt ist, trübt das hierzulande ebenfalls die Stimmung. Zum anderen zeigt sich die deutsche Wirtschaft wegen der anschwellenden geopolitischen Konflikte besorgt, etwa mit Blick auf den China-Taiwan-Konflikt: Käme es zum Krieg, würde aus dem »De-Risking« (eine politisch forcierte Reduzierung der Abhängigkeit von der Volksrepublik) schnell ein umfassender Rückzug werden (Stichwort Russland). Die gegenseitigen Handelsbeziehungen würden wohl weitgehend zum Erliegen kommen.
Allgemein gilt: In einem geopolitischen Umfeld, das zunehmend von Konflikten geprägt ist, geraten vormals stabile Produktions- und Lieferbeziehungen aus dem Gleichgewicht – eine schlechte Nachricht für die exportabhängige deutsche Wirtschaft. So könnten auch die Angriffe der Huthi im Roten Meer neben hohen Transportkosten zu Lieferengpässen führen – ein Szenario, das aus der Corona-Krise bekannt ist und die wirtschaftliche Erholung damals stark ausgebremst hatte.
Miele verlagert seine Produktion nach Polen: Ist das schon Deindustrialisierung?
Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten etliche Unternehmen medienwirksam angekündigt, das Vertrauen in den Standort Deutschland verloren zu haben. Das Szenario eines deindustrialisierten Deutschlands wird deshalb heftig diskutiert. Wenn sich die Bundesregierung jetzt nicht zusammenreiße, wagte etwa Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, eine verstörende Prognose, werde Deutschland bald »ein Naturschutzreservat« sein. Tatsächlich waren schon 2022 125 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen aus Deutschland abgeflossen, als hierzulande investiert wurden – der stärkste Abfluss seit 15 Jahren. Dazu passt, dass 2023 ein Drittel von 100 in einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) befragten Unternehmen angaben, über Produktionsverlagerungen nachzudenken. Nun verlagert ausgerechnet das »deutsche Traditionsunternehmen« Miele einen Teil seiner Produktion nach Polen – verbunden mit deutlicher Kritik an der Wirtschaftspolitik der Ampel. Die hohen Energiekosten, die durch die Abkopplung von Russland entstanden seien, eine überbordende Bürokratie, hohe Lohnkosten und Unternehmenssteuern hätten Miele kaum eine Wahl gelassen.
Wenn sich die Bundesregierung jetzt nicht zusammenreißt, wird Deutschland bald ein Naturschutzreservat
Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen
Weder die Kritik am Standort Deutschland noch Produktionsverlagerungen ins Ausland sind allerdings neue Phänomene. Osteuropa gilt längst als der günstige Hinterhof der deutschen Industrie. Auch Miele betreibt bereits Werke in Polen – und in Tschechien und Rumänien. Um Kosten zu sparen. Produktion wird aber auch verlagert, um neue Märkte zu erschließen, in der Vergangenheit vor allem nach China. VW macht fast 40 Prozent seines Umsatzes in der Volksrepublik. Die neoliberale Globalisierung seit den 1970er Jahren hat dem Kapital den Weg dafür freigemacht, Produktionsstandorte nach Profitabilitätsgesichtspunkten auszusuchen. Unter diesen Bedingungen ist aber auch das Drohen mit Produktionsverlagerungen zu einem eingeübten Ritual geworden – um die Politik zu Zugeständnissen zu bewegen oder Lohnforderung zurückzuweisen, auch in wirtschaftlich starken Zeiten. Das Unternehmen ankündigen zu gehen, heißt also nicht, dass sie das auch tun.
Richtig ist allerdings auch, dass die Industrieproduktion in Deutschland seit 2018 vor allem in den vormals starken Industriebranchen, der Auto-, der Metall- und der Maschinenbauindustrie deutlich gesunken ist – in der energieintensiven Chemieindustrie sogar um 20 Prozent. Der »Energiepreisschock« infolge des Ukrainekrieges setzte dieser besonders zu. Die Automobilindustrie leidet aber auch daran, dass mit den Verbrennungsmotoren jene Kerntechnologie schrittweise vom Markt gedrängt wird, die jahrzehntelang den enormen Wettbewerbsvorteil deutscher Autos begründet hatte. Bei der Umstellung auf Elektromobilität hat China längst auf- und überholt, was seit Jahren vorhergesagt worden war.
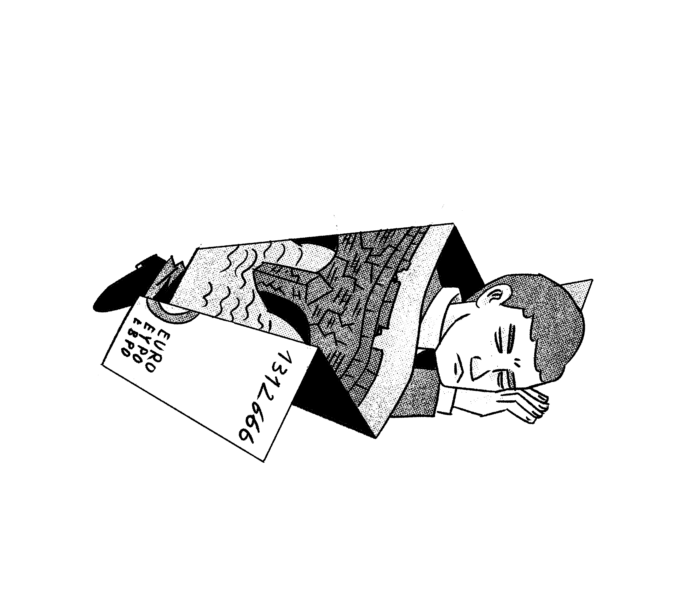
Der Strukturwandel ist nun da, und die industrielle Basis der Bundesrepublik wird sich ändern müssen. Auch weil die Gesellschaft altert und nicht mehr so viele Fach- und Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Dass in Deutschland Industriesektoren erodieren, bedeutet allerdings nicht, dass das Land in einem Prozess der Deindustrialisierung steckt: Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung ist hierzulande mit über 20 Prozent immer noch deutlich höher als in der Europäischen Union insgesamt (16 Prozent). Und: Bislang gehen gesamtwirtschaftlich betrachtet relativ wenig Stellen verloren. Arbeitsplätze werden langsam abgebaut; zudem entstehen Stellen in neuen Industriebranchen. Im vergangenen August kündigte Robert Habeck Großinvestitionen mit einem Volumen von insgesamt rund 80 Milliarden Euro im Bereich der Wasserstofferzeugung, Batteriezellfertigung und Mikroelektronik an, im Februar versprach auch der US-Konzern Microsoft mehr als drei Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Neue Stellen sind also im Entstehen, sie sind allerdings tariflich nicht so gut abgesichert, weil die Gewerkschaften hier weniger verankert sind. Das große Problem lautet also nicht »Deindustrialisierung« des Standortes, sondern »Entsicherung« von Beschäftigung.
Wie will Habeck den Standort Deutschland retten?
Wirtschaftsminister Habeck hat sich dennoch voll dem Narrativ vom untergehenden Standort angeschlossen. Im Wochentakt kommt er mit neuen Rettungsideen, eine davon: Standortpatriotismus. Es brauche mehr Mut für Investitionen im eigenen Land, sagte er in einem Podcast. Natürlich belässt er es nicht bei hilflosen moralischen Appellen. Ein sogenanntes Wachstumschancengesetz ist auf den Weg gebracht, hängt aber im Bundesrat fest. Die darin geplanten steuerlichen Vergünstigungen für die Wirtschaft in Höhe von sieben Milliarden Euro dürften am Ende viel geringer ausfallen.
Daher forderte Habeck kürzlich in einem Interview Steuererleichterungen und Steueranreize, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Denn in der Summe sei die Unternehmensbesteuerung in Deutschland im internationalen Vergleich zu hoch. Deutsche Unternehmen seien deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreudig genug.
Das nennt man Angebotspolitik oder neoliberale Wirtschaftspolitik: Die Profite sollen erhöht werden, damit von diesen mehr in Investitionen fließen. Dass das Management seine Investitionsentscheidungen auch nach Nachfragegesichtspunkten, dem Zustand der Infrastruktur oder der Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften trifft – darauf weisen keynesianische Ökonom*innen zu Recht hin.
An dem Argument des Wirtschaftsministers ist noch etwas anderes problematisch: Das Niveau der Besteuerung ist in Deutschland gar nicht so hoch, wie von den Unternehmen gerne kolportiert wird. In den letzten Jahrzehnten ist es beständig gesunken. Nominell zahlen Kapitalgesellschaften einen Steuersatz von ungefähr 30 Prozent. Auf das Wort »nominell« kommt es an. Aufgrund von Ausnahmen liegt der Satz real eher bei rund 20 Prozent – und damit im Mittelfeld in der EU.
Habecks Ideen findet Finanzminister Lidner gar nicht gut
Habeck hatte zwischenzeitlich auch ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung von Firmen vorgeschlagen. Sondervermögen heißt im Klartext Sonderschulden abseits des regulären Haushalts. Eine Idee, die Finanzminister Christian Lindner gar nicht gut findet. Zwar hat der FDP-Chef nichts gegen die Entlastung der Kapitalseite, aber keineswegs dürfe das durch neue Schulden finanziert werden. Sein umgehendes Nein zu Habecks Sondervermögens-Idee hat den Kollegen somit auf angebotspolitische Linie gebracht.
Warum will Lindner den Unternehmen kein Geld schenken?
Christian Lindner hat einen Fetisch, und der heißt Schuldenbremse. Die stellt er sogar über seine Vorliebe, die Kapitalseite zu entlasten. Warum? Lindner fürchtet, dass Staatsausgaben auf Pump die Inflation anheizen und staatliche Interventionen private Investitionen etwa für die Dekarbonisierung und Digitalisierung verdrängen könnten. Daher gelte es, »restriktive Fiskalimpulse zu setzen« und die Schuldenbremse einzuhalten, also Schulden abzubauen. Der Kurs des FDP-Ministers ist Neoliberalismus pur; dieser hält vom Staat nicht viel und singt das Loblied auf den freien Markt und das Unternehmertum. Deshalb lehnt Lindner staatliche Subventionen und Markteingriffe tendenziell ab – erst recht, wenn sie wie bei Habecks Vorschlag eines Sonderfonds schuldenfinanziert wären.
Bis Mitte November 2023, bis zum Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, hat es in der Ampelkoalition einen Kompromiss gegeben (ak 699): Lindner durfte sparen (ausgenommen beim Militär) und Sozialdemokrat*innen und Grüne konnten über Sonderfonds und Umschichtungen in Klimaschutz etc. investieren. Nach dem Karlsruher Urteil muss erst recht gespart werden, weil eine Reform der Schuldenbremse nicht in Sicht ist.
Das Problem: Sparhaushalte wirken gesamtwirtschaftlich nicht stimulierend. Im Gegenteil lassen sie nachfragebedingt das Wirtschaftswachstum einbrechen. Das sieht selbst Wirtschaftsminister Habeck so, der als Grund für die zurückgenommene Konjunkturprognose eben den strikteren Sparkurs angab.
Es ist auch nicht so, dass Deutschland zu viel Schulden hat – im Vergleich ist die deutsche Schuldenquote eher niedrig. Schulden führen zudem keineswegs zwangsläufig zu einer Inflation und sind auch nicht per se schlecht oder bürden den nachfolgenden Generationen finanzielle Lasten auf. Zum einen werden nicht nur Schulden vererbt, sondern auch die ihnen gegenüber stehenden Ansprüche auf Vermögen. Zum anderen profitieren auch spätere Generationen davon, wenn heute schuldenfinanziert die marode Infrastruktur in Schuss und die grüne Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft auf den Weg gebracht wird – Argumente, die selbst von Mainstream-Ökonom*innen immer stärker vorgetragen werden, die für eine Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse eintreten. Fatal, dass der Schuldenbremsen-Fetischist Lindner somit den Standort Deutschland ruiniert, könnte man argumentieren.
Gibt’s noch andere Ideen?
Doch damit sitzt man einer national-keynesianischen Sichtweise auf. Keineswegs kann es darum gehen, Deutschland wieder als wirtschaftliche Supermacht aufzubauen bzw. zu erhalten. Das auf Exporte beruhende Modell Deutschland ging auf Kosten der Nachbarländer, die nieder konkurriert wurden. Und es ging auf Kosten der Umwelt. Deutschland als Teil des frühindustrialisierten Globalen Nordens hat einen hohen Anteil an den Treibhausgasen, sein ökologischer Fußabdruck ist größer, als es mit den planetaren Grenzen zu vereinbaren ist. Um wieder innerhalb dieser zu gelangen, braucht es eine massive Reduktion des Energie- und Materialverbrauchs.
Hoffnungen, dass sich das Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch abkoppeln ließe, dass es ein grünes Wachstum geben könne, haben sich noch nicht erfüllt – und werden es auch nicht. Die globalen Emissionen sinken immer dann, wenn es große Wirtschaftskrisen gibt, die Produktion einbricht. Grün-keynesianische Konzepte, linke Green New Deals plädieren zwar richtigerweise für massive Investitionen in den Ausbau von Erneuerbaren und den ÖPNV. Doch sie lassen außer Acht, dass die Produktion neuer Schienen, Busse und Bahnen zunächst einmal Energie- und Ressourcenverbrauch voraussetzen – die an anderer Stelle einzusparen wären. Auch ist die Hoffnung auf technologische Lösungen beim Kampf gegen den Klimawandel, sei es der Umstieg auf E-Mobilität oder das Einfangen von CO2, illusionär. Beides ist ebenfalls mit einem hohen Energieaufwand verbunden, und gerade die E-Mobilität geht mit neuen Rohstoffausbeutungsstrukturen im Globalen Süden einher.
Ökosozialistische Ansätze plädieren daher für Konversion und einen Rückbau unnötiger industrieller Strukturen und die Einführung von festen Obergrenzen beim Energie- und Materialverbrauch, verbunden mit der Überführung der wichtigen Industrien in öffentliche Hand, um das kapitalistische Konkurrenzprinzip außer Kraft zu setzen. Denn der Zwang des Kapitals zur Expansion ist der eigentliche Treiber des Wirtschaftswachstums – ebenfalls kein Thema in grün-keynesianischen Konzepten, die ja gerade auf Wirtschaftswachstum setzen und die Eigentumsverhältnisse unberührt lassen.
Apropos Eigentumsverhältnisse: Dax-Konzerne scheffeln Milliarden – wie passt das mit der Krise zusammen?
Die Zahlen sind eindeutig: Laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young konnten zwei Drittel der 100 größten deutschen Unternehmen in den ersten drei Quartalen 2023 ihren Umsatz steigern und Gewinne auf Rekordniveau erzielen, ganz vorne dabei die angeblich krisengeschüttelte Automobil- und Zulieferindustrie. Volkswagen, Mercedes und BMW fuhren zwischen 14 bis 16 Milliarden Euro Gewinn ein. Und die Börsenkurse – stets eine Wette auf die Zukunft – kannten zumeist nur eine Richtung: nach oben. Insgesamt rund 52 Milliarden Euro Dividenden haben die 40 Dax-Unternehmen 2023 an ihre Aktionär*innen ausgeschüttet.
Das scheint nicht mit der miesen Stimmung in der Wirtschaft zusammenzugehen. Oder doch? Zum einen zeigt sich hier, dass Stellenstreichungen oder Standortverlagerungen aus Unternehmenssicht kein Beinbruch sind, im Gegenteil: Sie sind immer das Mittel der Wahl, um Kosten zu sparen und damit die Gewinne wieder nach oben zu treiben. Und zwar nicht im Interesse des Standort Deutschland, sondern im Interesse der jeweiligen Unternehmen. Zum anderen hat die Politik in den vergangenen Monaten bereits vieles unternommen, um den Unternehmen den Standort so attraktiv wie möglich zu machen, damit sie nicht abwandern.
Die Politik hat mit enormen Druck erweiterte »Energiepartnerschaften« mit Saudi-Arabien oder Aserbaidschan vorangetrieben, um günstiges Öl und Gas für die Industrie zu beschaffen; sie hat Vereinbarungen im Bereich der Rohstoffförderung abgeschlossen, in Argentinien und in Chile etwa, wo große Lithiumvorkommen lagern; sie hat eine Fachkräftestrategie verabschiedet und in Thailand und Vietnam um gut ausgebildete Kräfte geworben; die Unternehmen haben von Subventionen auf EU-Ebene und bis zum »Haushaltsstreit« in noch größerem Umfang von staatlichen Milliarden-Subventionen der Bundesregierung profitiert, die etwa die Energiepreise unten hielten. In dem Bemühen um die Ansiedlung eigener Chipindustrie verteilte der Staat zudem Milliarden an Intel, TSMC und Co, Konzerne, die im Osten Deutschlands neues Wachstum versprechen. Und die Unternehmen aller Branchen profitierten von anderen Förderinstrumenten, so zum Beispiel von Investitionsgarantien, mit denen der Bund Auslandsinvestitionen gegen Risiken absichert. Und nicht zuletzt boomt die deutsche Rüstungsindustrie, dank der forcierten Aufrüstung in diesen krisenhaften Zeiten. Rheinmetall gehört zu den absoluten Gewinnern im Dax.
Am Ende haben die deutschen Unternehmen also genau von dieser »miesen Stimmung im Land« profitiert, die die Politik spätestens seit der Corona-Pandemie in einen ungeahnten wirtschaftspolitischen Langzeit-Aktionismus getrieben hat (Stichwort »Bazooka«) und die es bis heute möglich macht, die Politik noch mehr als sonst vor der Wirtschaft herzutreiben. Die Extra-Gewinne, die die hohe Inflation beschert haben, waren da nur noch das Sahnehäubchen.