Forschen und kämpfen
Texte des marxistischen Historikers Walter Rodney aus den 1960er und 1970er Jahren erscheinen erstmals auf deutsch – sie sind erstaunlich aktuell
Von Robert Heinze
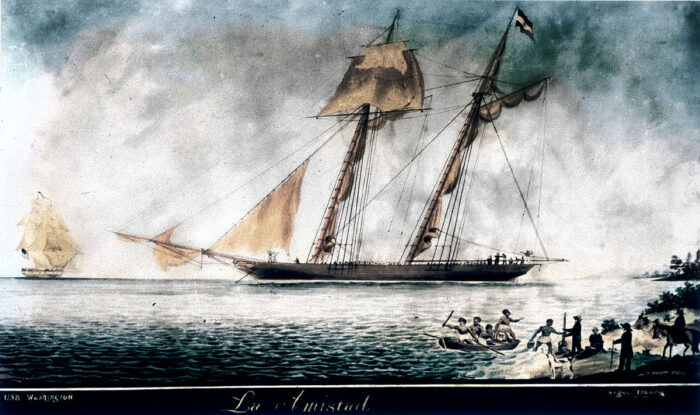
Es gibt nur wenige Texte, die zu ihrer Entstehungszeit wissenschaftlich bedeutsam sowie politisch wirksam waren und es geblieben sind. Dazu zählt Walter Rodneys Werk, vor allem sein Buch »Wie Europa Afrika unterentwickelte«, vor kurzem vom kleinen Berliner Manifest Verlag neu – und erstmals vollständig – übersetzt. Das Buch war nicht einfach für ein akademisches Publikum bestimmt. Rodney schrieb es auch, damit es von antikolonialen Aktivist*innen in Afrika und den Amerikas gelesen, diskutiert und genutzt werden konnte. Es sollte zur Befreiung aus den Zwängen beitragen, die es beschrieb. Stuart Hall nannte diese Sorte Text einmal einen »aktiven Text« – einen, der mit seinem Publikum wächst, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich genutzt wird und daher auch immer wieder an Aktualität gewinnt.
Wie Rodney selbst dazu beitrug, dieses Buch und dessen zentrale Thesen aktuell zu halten, und welche Lehren er für teils immer noch aktuelle Fragen daraus zog, zeigt die jetzt vom Karl-Dietz-Verlag besorgte Übersetzung der Aufsatz- und Vortragssammlung »Dekolonialer Marxismus«. Die Texte bilden zum einen die thematische Breite des guyanischen Historikers aus der Hauptphase seines Schaffens ab, zum anderen seine internationale Vernetzung und Einbettung in einen zeitgenössischen »Black Atlantic«. Entstanden sind die Texte in den 1960er und 1970er Jahren.
Rodney spottete über den Trend, in Afrika Bierfabriken zu bauen.
Den Marxisten und Panafrikanisten beschäftigte vor allem eine Frage: die nach den Gründen für die »Unterentwicklung« Afrikas und Lateinamerikas. Dabei ging es ihm nicht nur um die strukturellen Bedingungen dieser »Unterentwicklung«, sondern auch darum, wie unterschiedliche soziale und kulturelle Gruppen auf die Expansion des europäischen Kapitalismus – in Form des Sklavereikomplexes und durch die Kolonisierung weiter Teile der außereuropäischen Welt – reagiert hatten. Dabei hatte er lange gegen ein koloniales Establishment auch in der Geschichte Afrikas ankämpfen müssen. Diese Auseinandersetzung politisierte Rodneys Forschung, eine neue Geschichtsschreibung war für ihn nur noch in Verbindung mit einer neuen Pädagogik und einer politischen Bewegung für die Befreiung von imperialistischen Strukturen denkbar.
Komplexe Analyse des Imperialismus
Rodneys Antiimperialismus vermied jeglichen Reduktionismus, indem er sich auf die historisch-materialistische Analyse konkreter Gesellschaften gründete. Bereits in seiner Doktorarbeit hatte er auf die Komplexität der afrikanischen Reaktionen auf den transatlantischen Sklavereikomplex fokussiert und dabei auch die Handlungsmöglichkeiten lokaler Akteur*innen und die Eigenlogik afrikanischer Gesellschaften in dieser Zeit betont. Rodney legte sich dabei nicht nur mit den konservativen »Afrikahistoriker*innen« in Großbritannien an, sondern wandte sich auch gegen allzu reduktionistische, marxistische Modelle, die den Kapitalismus in Europa entstehen und von dort aus sich ausbreiten sahen. Stattdessen postulierte er – anschließend an andere afrikanische Marxisten wie Samir Amin und Harold Wolpe – eine Gleichzeitigkeit und »Artikulation« (Verschränkung) verschiedener Produktionsweisen, die die kapitalistische Expansion begleiteten und wesentlich mit beeinflussten.
Diese Methode, von einem komplizierten Gefüge verschiedener – lokaler, regionaler und globaler – historischer Prozesse und Faktoren auszugehen, die es jeweils historisch konkret zu analysieren galt, führte Rodney auch zu einer komplexen Analyse des Problems der »Unterentwicklung«. Nicht nur waren afrikanische Staaten durch die jahrhundertelange Ausplünderung ihrer Bevölkerung (und damit Arbeitskraft) im Handel mit versklavten Menschen sowie die durch die Kolonisierung etablierten Strukturen des »ungleichen Tauschs« in einem weltweiten Kapitalismus weiter von den Zentren abhängig. Die soziale Struktur dieser Länder und die Dominanz eines von den ehemaligen Metropolen abhängigen Kleinbürgertums, so Rodney, führe auch zu falschen Strategien, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. So spottete er über einen zeitgenössischen Trend in Afrika, »Bierfabriken« zu bauen, das heißt mit der sogenannten importsubstituierenden Industrialisierung die lokale Produktion von Waren zu ermöglichen, um sie nicht mehr importieren zu müssen und damit permanent in einer negativen Außenhandelsbilanz zu verharren. Denn solche Fabriken waren bereits damals schon oft nicht im Besitz lokaler Kapitalist*innen, sondern multinationaler Unternehmen, und auch in Public-Private-Partnerschaften behielten afrikanische Staaten nicht die Kontrolle über Produktion und Profite. Auch die Blockade technologischer Entwicklung oder die Tourismusindustrie, die die von ihr betroffenen Gebiete in »Kloaken« verwandele, kritisierte er.
Weitsicht
Rodney sparte auch nicht mit Kritik an afrikanischen Politiker*innen, deren autoritäre Tendenzen sich im Verlauf der 1970er Jahre zunehmend zeigten, und ebenso an afrikanischen »Progressiven«, die jenen reaktionären Staatschefs Ratschläge erteilten und sich einbildeten, sie könnten diese beeinflussen. Einer der wichtigsten Texte zur Analyse postkolonialer Gesellschaften in Afrika bleibt sein Aufsatz »Klassenwidersprüche in Tansania«, der im Band abgedruckt ist. Rodney beschreibt darin, warum Julius Nyereres Politik der Kollektivierung und Modernisierung der Landwirtschaft, die sogenannte Ujamaa, zum Scheitern verurteilt sei, so lange sie sich nicht den tatsächlichen Klassenverhältnissen im Land stellte – vor allem der Hegemonie eines großenteils verbeamteten Kleinbürgertums. An dieser Stelle zeigt sich eine absolut notwendige Ergänzung am Original, die der Karl Dietz Verlag neben der reinen Übersetzung vornahm, nämlich die Quellenangaben zu den einzelnen Texten. Warum der britische Verlag Verso darauf in seiner Ausgabe verzichtete, ist völlig unverständlich. Auch ein »aktiver Text« lebt davon, dass die Leser*in weiß, in welchem Kontext er entstand – in diesem Fall etwa wurde er erst 1980 veröffentlicht, aber bereits vorher, nämlich 1975 – mitten in der allgemeinen Euphorie über Ujamaa als sozialistischer Weg zur Entwicklung Afrikas – als Vortrag in Chicago gehalten. Insgesamt fokussiert der Band auf Texte aus Rodneys akademischer Hauptschaffensphase; aber auch später, als oppositioneller, sozialistischer Politiker in Guyana blieb er als Historiker aktiv und schrieb an einer posthum veröffentlichte Geschichte der Arbeiter*innenklasse Guyanas.
Die Aktualität von Rodneys Thesen ist manchmal verblüffend – so schrieb der niederländische Journalist Olivier van Beemen erst 2019 ein ganzes Buch darüber, dass viele lokale Biermarken in Afrika vom multinationalen Heineken-Konzern kontrolliert sind und deren Produktion kaum der jeweiligen lokalen Wirtschaft zugutekommt. Ihre Radikalität ist weiterhin ein nützlicher Konter zu Tendenzen auch im »progressiven« Mainstream, die »Unterentwicklung« Afrikas durch den Kolonialismus zuzugestehen, aber von der aktuellen Struktur des globalen Kapitalismus abzukoppeln. Rodneys politischer Aktivismus schließlich ist eine Mahnung an heutige progressive Sozialwissenschaftler*innen, sich nicht darauf zu verlassen, dass es mit akademischen Schriften getan ist.
Walter Rodney: Dekolonialer Marxismus. Schriften aus der panafrikanischen Revolution. Dietz Berlin, Berlin 2024. 264 Seiten, 29 EUR.