Am meisten weinen die Gewinner
Mixed Martial Arts ist ein Modekampfsport, dessen Stars sich vor allem durch rechte Männlichkeitspropaganda auszeichnen
Von Vincent Bababoutilabo und Lisa Schank
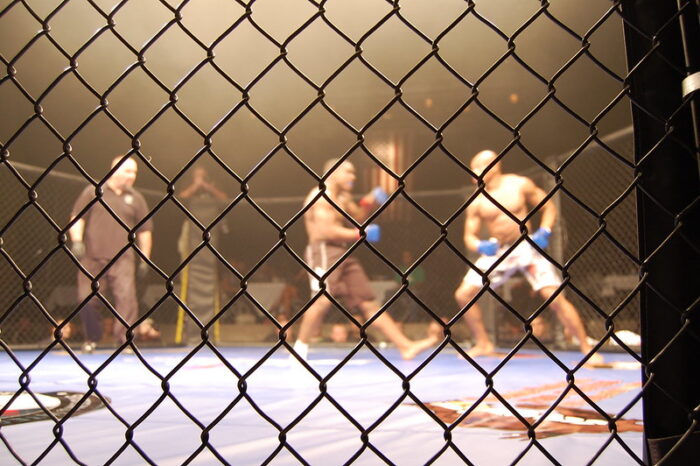
MMA (Mixed Martial Arts) hat zur Zeit mehr Zulauf als jede andere Sportart der Welt. Mit dem modernen Kampfsport wächst auch die Popularität einer komplexen Form der Männlichkeit, die nicht nur Stärke, Härte und Durchhaltevermögen propagiert, sondern auch Schwäche, Emotionalität und Kitsch.
MMA-Kämpfe sind oft sehr blutig, manchmal brechen Körperteile oder Menschen werden k.o. geschlagen. In einem Käfig kombinieren die Sportler*innen Techniken aus dem Kickboxen mit Griffen aus unterschiedliche Ringkampfsportarten. Die Ultimate Fighting Championship (UFC), die bekannteste und größte MMA-Firma und Liga, ist die neoliberale Gesamtscheiße im Kleinen. Hunderte von Kämpfer*innen schlagen sich um schlechte, befristete Arbeitsverträge. Die meisten müssen neben dem harten Training tagsüber noch Nebenjobs ausüben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Einige wenige Stars verdienen Millionen, während die große Mehrheit der Kämpfer*innen verarmt und die meiste Zeit über noch nicht einmal krankenversichert ist. »Alleinerziehende Mütter empfangen Sozialhilfe, echte Männer nicht!«, fasste es das Leichtgewicht Eddie Alvarez stolz in einem Interview mit dem Sender Fox Sports zusammen.
Rechte Kämpfer*innen
Wenn sich Kämpfer*innen politisch äußern, dann positionieren sie sich meistens eher rechts als links. »Better dead than read – Lieber tot als rot«, sagte Rose Namajunas, bevor sie gegen die Chinesin Zhang Weili kämpfte. »Lula in den Knast und Bolsonaro 2018«, schrie das Mittelgewicht Darren Till nach einem besonders beeindruckenden Sieg.
Der Boss der Firma, Dana White, ist ein Multimilliardär. Er ist sehr gut mit Donald Trump befreundet und führt die UFC wie ein Tyrann. Wenn sich Kämpfende wegen schlechter Bezahlung beschweren, sagt er meistens Dinge wie: »Niemand muss hier kämpfen«, »Ihr könnt gerne woanders hingehen« oder ganz der liberalen Aufstiegslüge verpflichtet: »Die UFC ist kein Job, sondern eine Chance.« Die Kämpfer*innen, von der Hoffnung angetrieben, einmal ganz Oben anzukommen und Champion zu sein, setzen ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel und erarbeiten den Wert des Unternehmens.
Männer prügeln sich
Um in der UFC zu gewinnen, so scheint es, braucht es Aggressivität, Durchsetzungsstärke, körperliche Überlegenheit, emotionslosen Killerinstinkt und Alphatiergehabe. Doch als Paddy Pimblett nach einem überraschenden Sieg in der ausverkauften o2-Arena in London das Mikrophon ergriff, brach er radikal mit dieser Vorstellung. Einer seiner Freunde habe sich vor kurzem umgebracht, weil er es versäumt habe, in einem Moment der Schwäche nach Hilfe zu fragen. Begleitet von tosendem Applaus schrie er sichtlich emotionalisiert: »Wenn du ein Mann bist: Leute würden dich lieber an ihrer Schulter ausweinen lassen, als zu deiner Beerdigung zu gehen. Deshalb: Männer, redet!«
Pimblett ist mit diesem Appell nicht allein. Tyson Fury, Schwergewichtsweltmeister im Boxen, baute das Narrativ seiner Karriere um seinen schwierigen Kampf gegen Depressionen und Kokainsucht auf und sammelt Geld für den »Men’s Mental Health Charity Talk Club«, in dem Männer zusammenkommen, um über Gefühle zu reden.
Die wohl überraschendste Männlichkeitsperformanz präsentiert der MMA-Kämpfer Rodolfo Vieira. Der überzeugte Bolsonaro-Unterstützer spricht in Interviews häufig von seiner Angst vor dem Kämpfen. Zwischen den Runden sitzt er in der Ecke, hat sichtlich mit Panik zu kämpfen und wird von seinen Trainern emotional aufgebaut.
Frauen haben in der UFC überraschend großen Erfolg. Anders als im Fußball gibt es mehrere weibliche Kampfsportsuperstars. Über Sexismus und negative Erfahrungen der Kämpferinnen wird jedoch nicht gerne gesprochen. Als eine junge Reporterin die Bantamgewicht-Meisterin Holly Holmes nach Sexismus in der Branche fragte, drängten sie einige Betrunkene vom Mikrofon weg, brüllten »Fuck ISIS« und die Arena übertönte sie mit lautem Geschrei.
Religiöse Männer
Wenig gut kommt die Präsenz von Frauen bei den zahlreichen konservativ-muslimischen Kämpfern in der UFC an. Als der berühmteste unter ihnen, Khabib Nurmagomedov aus Dagestan/Nordkaukasus, nach Tipps für weibliche Kämpferinnen gefragt wurde, antwortete er nur lakonisch: »Seid gute Kämpferinnen zuhause«. Er und die mit ihm assoziierten Kämpfer leben mit strengen Regeln. Sie trainieren, beten und leben gemeinsam. Gott habe ihnen alles gegeben, deshalb gehe es darum, seine Regeln zu befolgen. Nach einem Hip-Hop-Konzert in Dagestans Hauptstadt Machatschkala, auf dem Teenager lediglich Texte mitsangen, ermahnte Nurmagomedov die Jugend empört, nicht vom rechtschaffenden Weg der Vorfahren abzukommen. Sein Kollege und enger Freund Islam Makhachev bezeichnete das Event als »Treibstoff für die Hölle«.
Wer sich 25 Minuten lang mit einem anderen Mann in einem Käfig geprügelt hat, darf danach auch ein paar Tränen verdrücken.
Kommentiert wird dieses Verhalten von Seiten der UFC-Medienmacher*innen meist mit Kulturrelativismus. In Dagestan sei das Leben nun mal superreligiös und härter als im verweichlichten Westen. Auch Nurmagomedovs emotionalen Ausbrüche genießen hohes Ansehen. Als er am 24. Oktober 2020 seinen Titel verteidigte, brach er nach dem Kampf weinend zusammen. »Gott hat mir alles gegeben. Es war mein letzter Kampf.« Sein finaler Wunsch an diesem Tag war es, dass die UFC ihn zum besten Kämpfer der Welt erklärt, um den Plan seines kürzlich gestorbenen Vaters zu realisieren. Diesen Männlichkeits-Kitsch bewundernd, schlussfolgert der MMA-Kommentator und Host des meistgehörten Podcasts der Welt, Joe Rogan: Muslime haben etwas behalten, das »wir« im Westen verloren haben.
Den konservativ-muslimischen Mann als Gegenstück zur westlichen Weiblichkeit zu bewundern, ist in der Szene weit verbreitet. Männer im Westen, so kommentierte es Brian Davis, ein weiterer weltberühmter Podcaster, fühlten sich nicht mehr mächtig. In einem Interview mit Mohammad Hijab, dem wohl bekanntesten, rechtsoffenen Islamprediger des Internets, stellt er fest, dass verloren gehe, was es früher bedeutete, ein Mann zu sein. »Und jetzt gibt es diese Kampfsport-Welle von echten Alpha-Männern, die auch über ihre Religion sprechen, insbesondere über den Islam.« Hijab, sichtlich zufrieden, weist darauf hin, dass fast alle Champions entweder Muslime oder Christen seien. Es gebe keine atheistischen Kämpfer, ihnen fehle es an Kraft.
Um eine Zeit, in der Männer noch richtige Männer waren, wird häufig auch im deutschen Kontext getrauert, denn mit der Männlichkeit sei auch der deutsche Nationalstolz verschwunden. Der YouTube-Star und Kampfsport-Kommentator Edmund Avagyan meint es ernst: »Die Deutschen waren ein starkes und stolzes Volk. (…). Die wurden über die Dauer verweichlicht. Die Ausländer tun sich zusammen und mobben die Deutschen dafür, dass sie Deutsche sind.« Deutsche, so Avgayan, werden von Jugend an »kastriert«. Hier verbinden sich faschistoide Vorstellungen von der untergangenen Größe des deutschen Volkes mit Phallusträumen.
Gefühle und Gewalt
In der modernen Kampfsport-Industrie verbindet sich ein archaisches Männlichkeitsbild mit einer neoliberalen Achtsamkeitsideologie. Schlagt euch in die Fresse, aber passt auf euch auf! Kampfsport, lange als Freizeitbeschäftigung blutrünstiger Nazihooligans abgetan, wird dadurch anschlussfähiger für größere Zielgruppen. »Verkaufe nicht Produkte, sondern Emotionen«, ist nicht umsonst ein im Marketing beliebtes Motto. Hinzu kommt: In all den Emotionen werden oft klassisch konservative oder neoliberale Werte propagiert. Familie: Man(n) wird emotional, wenn man an die Eltern oder Kinder denkt. Leistung: Man(n) erlaubt sich einen kurzen Moment der Schwäche, wenn er über die Entbehrungen spricht, die er auf sich nimmt, um da zu stehen, wo man heute steht. Aber eben auch Achtsamkeit: Man(n) braucht, um es im Leben nach ganz oben zu schaffen, auch ein erfolgreiches Emotionsmanagement. Wer sich 25 Minuten lang mit einem anderen Mann in einem Käfig geprügelt hat, darf danach auch ein paar Tränen verdrücken. Schwäche gibt es hier nur in Kombination mit Härte. Mit Hypermaskulinität wird so nicht gebrochen. Denn eines fällt auf: Am meisten weinen die Gewinner.

