Pfeifen im dunkelblauen Wald?
Fragen an eine antifaschistische Praxis abseits von Glamour und aktivistischen Ritualen
Von Marcel Hartwig
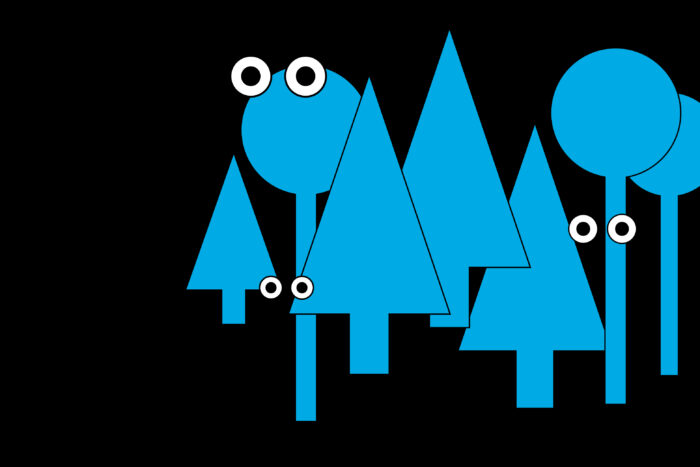
Dass die AfD in Brandenburg knapp unter der 30-Prozent-Marke blieb, wurde medial aufgenommen, als habe die Partei nicht 29,2, sondern 5,2 Prozent erreicht. In den kommenden Wochen wird sich viel um eine Regierungsbeteiligung des BSW drehen. Dass die AfD in drei Landtagen mit rund 30 Prozent einzog, verursacht in der Bundespolitik keine Bugwelle mehr. Ein Grund ist, dass sich die absehbare politische Raumnahme der AfD in der medialen Wahrnehmung nur im Osten abspielt, wo viele, nicht zu Unrecht, das Kraftzentrum der Partei vermuten. Da die numerische Zahl der ostdeutschen Wähler*innen aber gemessen an jener in NRW klein ist, und das Problem einer erstarkenden extremen Rechten gern auf den Osten projiziert wird, fallen die Reaktionen einer kritischen Öffentlichkeit ermüdet statt empört aus.
Die harten Fakten nach drei ostdeutschen Wahlen: Die AfD erreichte in Brandenburg und Thüringen das Quorum einer Sperrminorität. Parlamentarische Entscheidungen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, können gegen die AfD nur schwerlich durchgesetzt werden. Die AfD wird in keinem der drei Bundesländer an der Regierung beteiligt sein. Alles also halb so schlimm? Nicht wirklich. In Thüringen nutzte die AfD ihre neue Machtfülle umgehend dazu, das parlamentarische Prozedere in der ersten Sitzung des Landtages zu ihren Gunsten auszuhebeln.
»Es wird in Ostdeutschland eine Realität geben, die sich nicht widerspiegeln wird in der Kriminalstatistik, in Zitaten in Zeitungen, in Gesichtern im Fernsehen«, kommentierte Daniel Schulz treffend in der taz. Dies reflektiert, dass sich die Gegner*innen der AfD in eine Position der Anpassung und der Rechtfertigung gedrängt sehen. Die Mechanismen subtilen Drucks wurden von Antifaschist*innen im Osten seit den frühen 1990er Jahren vielfach beschrieben. Damals bezog sich dies auf die regionalen Hegemonieräume einer rechten Jugendkultur. Heute spiegelt sich darin das Maß an Zustimmung, die örtlich weit über dreißig Prozent liegt. Die Normalisierung von rechts bedeutet, dass der regionale Bauunternehmer oder die Gartennachbarin ihre Zustimmung zu rechten und rassistischen Talking Points ungefragt allen auf die Nase binden – gerade denen, die aus welchen Gründen auch immer Distanz zu rechten Sprech- und Erlebnisräumen wahren (müssen). Dem aus dem Weg zu gehen, geht so lange gut, solange man nicht mit den lokalen rechten Lautsprechern vor Ort in Konflikt gerät, sich unsichtbar machen oder temporäre Fluchten antreten kann. Anders gesagt: Wen die rechten Akteure in Orten, wo alle sich kennen, auf dem Kieker haben, der*dem können sie das Leben zur Hölle machen – zunächst auch ohne Gewalt.
Jedwede Strategie gegen die AfD muss in den Blick nehmen, was derzeit in Ostdeutschland geschieht, wenn von Etablierung der Partei die Rede ist. Allein ihr Erfolg macht die AfD noch erfolgreicher. Es stimmt: Die AfD macht inhaltlich und handwerklich eine grottenschlechte Politik, die sich gerade gegen die materiellen Interessen jener richtet, die sie wählen. Es stimmt aber auch: Nicht wenigen Anhänger*innen der Partei ist dies ausdrücklich scheißegal. Sie beziehen ihre Selbstaufwertung aus der Identifikation mit dem rassistisch-autoritären Projekt, das sich mit der AfD verbindet. Besonders erfolgreich ist die AfD dort, wo Abwanderung und Rückbau sozialer Infrastruktur die Gesellschaft aushöhlen, wo Entsolidarisierung, Fragmentierung und Abstiegsangst ein toxisches Gemisch mit breit akzeptierten rechten Einstellungsmustern und der Realität rechter Gewalt eingehen. Wir sind in einigen Regionen Ostdeutschlands Zeugen des Übergangs der AfD von Diskursdominanz zu Formen der Normalisierung, die absehbar die politische Einbindung der AfD zur Folge haben wird.
Das F-Wort und linke Deutungsmuster
Linke aller Couleur hantieren wieder mit dem Faschismusbegriff. Der Faschismus stünde nicht nur vor, nein in der Haustür und sei auf dem Sprung zur Macht – das sagen selbst Linksliberale. Zweifellos ist die AfD eine extrem rechte Partei mit einer wirkmächtigen innerparteilichen faschistischen Pressure-Group, der derzeit scheinbar alles einfach in den Schoß fällt. Andere Kriterien für die Zumessung des Attributs »faschistisch« erfüllt die Partei inzwischen ebenfalls.
Wer aber das F-Wort in den Mund nimmt, erzeugt Bilder in den Köpfen: Uniformierte SA-Kolonnen, die durch Städte ziehen, gefolgt von amtlichen Verboten von Gewerkschaften und Zeitungen. Diese historischen Bilder sind bis in die Gegenwart wirkmächtig. Doch sie verstellen den Blick auf die heutige Gefahr. Der Machtzuwachs der AfD wird nicht mit uniformierten Aufmärschen im Stil der 1930er Jahre einhergehen. Vorerst wird sich nichts über Nacht schlagartig ändern. Wer den Frosch kochen will, wirft ihn nicht in heißes Wasser, aus dem er erschrocken herausspringt; er erhöht Schritt für Schritt die Temperatur des Wassers im Topf, bis es für den Frosch zu spät ist …
Anders gesagt: Die stetig voran getriebene autoritären Formierung, an der konservative und andere politische Kräfte mitwirken, ist die Gefahr. Die linke Warnung vor dem Faschismus ist moralisch-emotional verständlich, erzeugt aber unscharfe Vorstellungen, was die Erfolge der AfD konkret im Alltag von marginalisierten Menschen und Gegner*innen der Partei bedeuten. Gewiss, nichts liegt Faschist*innen näher, als eine politische Disruption herbeizureden, in der sie dann die politischen Akteure der Stunde sind. In den Krisen der Zeit kann ein disruptives Momentum eintreten. Wahrscheinlicher ist aber eine prozesshafte autoritäre Zuspitzung, deren einzelne Stufen als gar nicht so gravierend wahrgenommen werden, wie sich in der gegenwärtigen Asyldebatte bereits abzeichnet. Wer also den Faschismusbegriff zur Hand nehmen will, muss feingliedriger analysieren, um nicht in grobe Vereinfachung zu verfallen. Lehrbuchwissen zu Faschismustheorien allein hilft nicht mehr.
Linke Protestrituale helfen nicht
Die rasanten Erfolge der AfD machen es für Linke unmöglich, mit der Dynamik auch nur Schritt zu halten. In den vergangenen Monaten gab es Aufrufe zur Neukonstitution einer antifaschistischen Bewegung. Diese verstecken hinter ihren überkommenen rhetorischen Ritualen der Selbstpositionierungen und Abgrenzungen ihr ratloses Pfeifen im dunkelblauen (AfD)-Wald. Eine antifaschistische Bewegung lässt sich nicht mit Social Media Posts herbeiführen, nicht als Kampagne planen, nicht unter dem Druck der Ereignisse organisieren. Die Bedingungen für ihre Neuentstehung sind nicht gut – machen wir uns da nichts vor. (Bewegungs-)linke Selbstwirksamkeit wird über Demonstrationen, Kundgebungen und Kampagnen realisiert. Die Proteste gegen Landes- und Bundesparteitage oder gegen die Wahlerfolge der letzten Monate binden Ressourcen linker Gruppen. Zugleich ist die Wirkung selbst von Großdemonstrationen im Zeitalter digitaler Aufmerksamkeitsspannen kurz. Die Proteste zu Beginn des Jahres mobilisierten viele Menschen. Sie hatten für die jetzige Situation nach den Landtagswahlen keinerlei Effekt, weil sich aus ihnen nichts entwickelte, was die Resonanz der Gegner*innen der AfD verstetigt hätte.
Lehrbuchwissen zu Faschismustheorien reicht nicht aus.
Ob vermummt mit Rauchtöpfen, oder singend mit Plakaten gegen rechts; solche politischen Praxen vertreiben für den Augenblick die eigene Ohnmacht, mehr nicht. Dies gilt in Ostdeutschland umso mehr. Außerhalb ihres Umfeldes in Großstädten sind Linke dort nachgerade unsichtbar. Ihr subkultureller Habitus schafft zwar Freiräume der Selbstermächtigung von unten, begrenzt die Resonanzräume linker Inhalte jedoch zugleich, und macht ihre Protagonist*innen verwundbar gegenüber den negativen Zuschreibungen der Konservativen. Das ist kein Argument gegen Subkultur. Es ist eine Beschreibung der Existenzbedingungen linker Lebenswelten im Osten.
Wenn es stimmt, dass Aufwand und Nutzen von Demonstrationen, Kundgebungen und Plakaten gegen die AfD in keinem sinnvollen Verhältnis zur Dimension der Gefahr von rechts stehen, ist es dran, das aktionistische Verständnis antifaschistischen Engagements zu überprüfen.
Wie wäre es mit dem Versuch, die Resilienz der eigenen Strukturen zu stärken, die lokale Verankerung auszubauen, funktionierende Netzwerke mit jenen aufzubauen, die von den Folgen der AfD-Politik betroffen sein werden. Vereine können ihre Satzungen politisch wetterfest machen, linke Polit-Gruppen in den Metropolen priorisieren, worauf sie ihr Hauptaugenmerk legen, wenn die AfD weitere gesellschaftliche Terraingewinne erzielt. Wem gilt die praktische Solidarität, wenn die AfD zum Schlag gegen ihre Gegner*innen ausholt? Wie kann ein Mindestmaß an Sichtbarkeit linker Positionen gewährleistet werden, wenn die AfD daran geht, die Kritik an ihr mundtot zu machen?
Die vielzitierte Komfortzone politischen Aktivismus zu verlassen, heißt zu fragen, was die am stärksten von der rechten Normalisierung betroffenen Menschen brauchen – auch wenn sie dem eigenen politischen Selbstverständnis nicht entsprechen. Solidarität zu propagieren, auf Partys zu feiern, na schön. Sie langfristig, strategisch durchdacht und praktisch zu üben, braucht Denkräume, einen weiten Horizont, Kontakte, Verbindlichkeit und nicht zuletzt eine Reflexion der eigenen Belastbarkeit und ihrer Grenzen.
Es muss um Netzwerke konkreter Unterstützung gehen, wenn Menschen, die in AfD-Hochburgen gegen die extreme Rechte aktiv sind, ausbrennen, bedroht werden. Es braucht konkrete Hilfe, persönliche Begleitung und Unterstützung.
All das sind wahrlich keine Aktivitäten, die den eigenen politischen Fame mehren oder mit denen Linke in eine politische Offensive kommen. Im Gegenteil. Diese Vorschläge sind dezidiert defensiv, und sollen es Menschen und Strukturen ermöglichen, politische und persönliche Angriffe so zu überstehen, dass sie ihre individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit erhalten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.