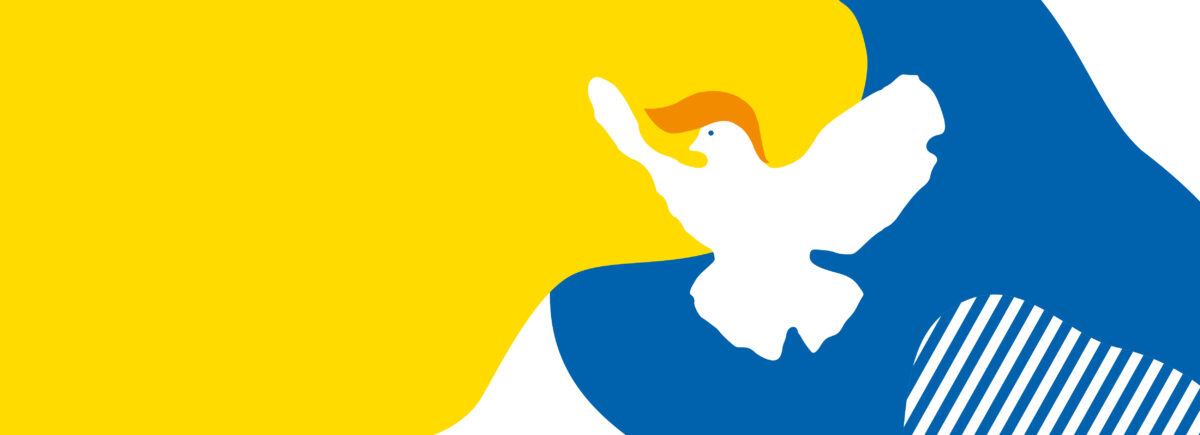Abstand halten zur Politik
Die russische Bevölkerung versucht, den Krieg so gut es geht zu verdrängen, die Auswirkungen sind aber immer öfter zu spüren

Die meisten Menschen in Russland beobachten den Krieg nur aus der Ferne. Aber in den letzten Monaten rückte er näher. Im September schlug eine Drohne am östlichen Stadtrand von Moskau in einem Hochhaus ein. Meist reagiert die Flugabwehr, bevor die Geschosse ihr Ziel erreichen. Trotzdem kam es in immer mehr russischen Regionen durch Drohnenangriffe zu signifikanten Schäden. Besonders betroffen ist die ölverarbeitende Industrie. Es ist kein Vergleich zu den Zerstörungen, die Russlands Armee der Ukraine zufügt, und dennoch keine Kleinigkeit. Über zivile Opfer in den Grenzregionen Kursk oder Belgorod wird in den russischen Staatsmedien zwar berichtet, nicht hingegen über erhebliche Defizite bei der Unterstützung von Betroffenen der Bombardements und Evakuierungen.
Selbst, wer keine Angehörigen an der Front hat oder in für die Kriegsführung zentralen Wirtschaftsbereichen arbeitet, trifft im Alltag auf unmittelbare und mittelbare Auswirkungen der sogenannten militärischen Spezialoperation. In Handwerkerkreisen etwa wird genau unterschieden zwischen der Zeit vor und nach Kriegsbeginn, da sanktionsbedingt etliche aus dem westlichen Ausland importierte hochwertige Ersatzteile selbst für hauswirtschaftliche Geräte wie Waschmaschinen nicht mehr verfügbar sind. Während die Moskauer Stadtverwaltung zur Aufrechterhaltung des schönen Scheins nach wie vor Unsummen für Neujahrsdekorationen und dergleichen ausgibt, fehlt es in vielen Regionen mittlerweile an Finanzmitteln zur Umsetzung stadtplanerischer Maßnahmen.
Krieg und Alltag
In der Nähe von Militärkrankenhäusern, an Flughäfen und Bahnhöfen sind Armeeangehörige nicht zu übersehen. In den Medien finden sich immer wieder Meldungen über ausgerastete Frontrückkehrer, nicht selten enden solche Gewaltexzesse tödlich. Gerade in Zügen finden zwangsläufig Begegnungen mit Kriegsteilnehmern statt. So hatte auch die Autorin die Gelegenheit, Zeugin von nicht enden wollenden Ausschweifungen eines Angehörigen einer Spezialeinheit zu sein, der sich dabei zugleich als Gentlemen versuchte zu inszenieren.
Eine Bekannte hatte weniger Glück. Im Schlafwagen eines von Rostow Richtung Norden fahrenden Zuges begann ein betrunkener Söldner derart zu randalieren, dass ihn bei einem außerplanmäßigen Halt schließlich die Militärpolizei abführte. Der an dessen Stelle eingestiegene Passagier konsumierte zwar keinen Alkohol, gab jedoch Kriegsanekdoten zum Besten: Einmal habe er sich wochenlang keiner Körperwäsche unterziehen können, bis er sich nach der Einnahme einer ukrainischen Stadt schließlich in ein Schwimmbad gestürzt habe. Das Wasser habe sich daraufhin rot gefärbt. Er lachte, die anderen Passagiere nicht.
Immer wieder gibt es Meldungen über ausgerastete Frontrückkehrer, nicht selten enden solche Gewaltexzesse tödlich.
Sicherlich versucht ein Teil der russischen Bevölkerung, den Krieg und seine Folgen weitgehend zu verdrängen. Manche profitieren durch gestiegene Löhne, beispielsweise in der IT-Branche. Gleichzeitig nimmt ein Gefühl der Unsicherheit zu, etwa weil sukzessiv Garantien wegfallen, die es Großbetrieben bislang ermöglichten, schwer zu ersetzende Beschäftigte zurückstellen zu lassen. Bislang sieht die Regierung wohlweislich von einer totalen Mobilmachung ab, da die Bereitschaft, sich für nebulöse Kriegsziele zu opfern, nur gering ausgeprägt ist. Selbst gegen reichliche Bezahlung finden sich nicht genügend neue Rekruten.
Im Übrigen ist der Wunsch nach Frieden in weiten Teilen der Gesellschaft durchaus vorhanden, doch folgt daraus nicht automatisch eine Reflexion über Kriegsursachen oder gar der eigenen Verantwortung für das Geschehen. Wo schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges bei der überwiegenden Mehrheit Politikabstinenz dominierte, hat sich daran in den vergangenen drei Jahren nichts wesentlich verändert. Zumal legale Optionen für politische Teilhabe durch die Kriminalisierung staatskritischer Äußerungen, insbesondere hinsichtlich der Kriegsführung, immer weiter eingeschränkt wurden und inzwischen nur noch rudimentär vorhanden sind. Es fehlt schlichtweg der Glaube, durch eigenes Zutun den Krieg beenden zu können.
Wie schwer sich unpolitische beziehungsweise staatsloyale Bürger*innen damit tun, ihre Ansichten zu hinterfragen, zeigt die Erfahrung überwiegend weiblicher Angehöriger der im Rahmen der im September 2022 ausgerufenen Teilmobilmachung zum Kriegsdienst eingezogenen Soldaten. Viele hatte die Einziehung überrumpelt, zumal die Regierung damals nicht kommuniziert hatte, dass die Rekruten bis zum Kriegsende an der Front bleiben sollen. Schließlich gründeten einige die Bewegung Weg nach Hause.
Ein Rest Protest
Zunächst hingen die darin organisierten Angehörigen dem Glauben an, es reiche aus, Behörden und Entscheidungsträger*innen mit Anfragen und Beschwerden zu überhäufen, um die Entlassung der eigenen Verwandten aus dem Armeedienst zu erreichen. Im Herbst 2023 und auch noch Anfang 2024 trugen die Frauen ihren Protest auf die Straße, etwa mit Kundgebungen vor den Kreml-Mauern. Einige wenige unter ihnen waren mutig genug, den Krieg als solchen offen abzulehnen und nicht nur die Teilmobilmachung. Bei anderen regten sich Zweifel an den diffusen Kriegszielen. Oder es blieb bei Enttäuschung angesichts der Ignoranz staatlicher Stellen gegenüber ihrem, wie sie meinten, legitimen Wunsch, ihr privates Familienleben fortzuführen. Inzwischen stufte das Justizministerium die Bewegung als »ausländischen Agenten« ein, die Proteste sind weitgehend eingeschlafen. Einige der Frauen wurden deswegen zu Geldstrafen verurteilt, in staatlichen Medien wurden sie diffamiert.
Das Labor für öffentliche Soziologie, eine informelle Gruppe russischer Soziolog*innen, legte im Januar einen Bericht über die Bewegung vor. Die Soziolog*innen hatten mit einer Reihe in der Bewegung aktiver Frauen gesprochen, deren Handlungsmotive erfasst und kamen zu dem Schluss, dass der Protest nicht auf geteilten politischen Einschätzungen beruhte. Vielmehr agierten die Frauen im Rahmen konservativer sozialer Rollenverteilungen als Beschützerinnen ihrer Söhne oder Interessenvertreterinnen ihrer Ehemänner. Erst die Erfahrung staatlicher Ignoranz gegenüber ihren Forderungen stimulierte in ihnen die Bereitschaft, den Protest auf die Straße zu tragen.
Widerstand gegen den Krieg, der diesen Namen verdient, gibt es trotzdem. Oft allerdings nur im kleinen Rahmen – Kunstausstellungen mit mehr oder weniger kryptischen Botschaften, stille Verweigerung, an patriotischen Veranstaltungen am Arbeitsplatz teilzunehmen, das Abhängen von Plakaten, die zum Armeeeintritt auffordern, Wehrdienstverweigerung, Desertieren. Seit 2022 fanden auch Dutzende Sabotageakte statt, um Waffen- und Munitionstransporte zu behindern oder die Versorgung der Front mit Benzin zu unterbinden. Auch Angriffe auf Rekrutierungsbüros und andere Einrichtungen gab es. Allerdings wird ein wachsender Teil dieser Anschläge von Menschen verübt, die sich von Telefonbetrüger*innen dazu haben verleiten bzw. erpressen lassen.
Das Schema: Anrufer*innen geben sich als Bankangestellte, Polizist*innen oder Geheimdienstangehörige aus und nötigen ihre Opfer unter falschen Vorwänden zu Taten, die diese aus freien Stücken nie begangen hätten. Oft wurden die Opfer im Zusammenspiel mehrerer solcher Anrufe überzeugt, ihre Ersparnisse auf falsche Konten zu überweisen, wodurch sie auch finanziell erpressbar wurden. Im Dezember 2024 kam es zu einer regelrechten Welle solcher Anschläge. Erst kürzlich wurde eine Rentnerin wegen Terrorismus zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie hatte einen Molotow-Cocktail auf einen Kleinbus vor dem Leningrader Militärkommissariat geworfen, ihr Ziel jedoch verfehlt. Nur ein Auto brannte aus.