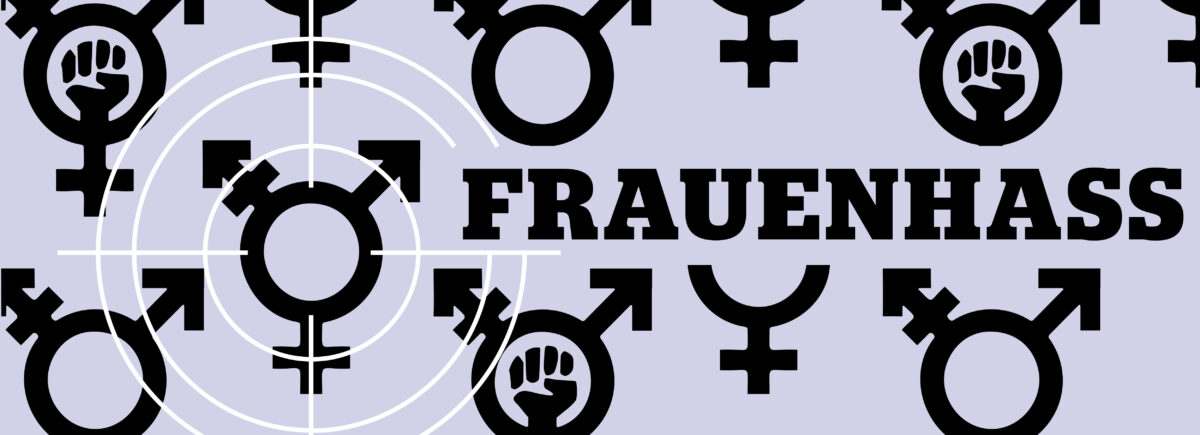Gefährliche Genossen
Frauenhass ist auch in der linken Szene ein Problem – warum ist das so, und was hilft dagegen?
Von Bilke Schnibbe

Von Filmaufnahmen auf den Dixies eines linken Festivals über Linke-MeToo bis hin zu einem ehemaligen Antifa, den ein Szeneanwalt gegen eine Genossin in einem Sexualstrafverfahren verteidigte – in den letzten Jahren gab es einige prominente Beispiele, die gezeigt haben, dass Frauenhass ein deutliches Problem in deutschen linken Strukturen ist.
In den Debatten über diese Fälle sind Probleme im Umgang mit sexueller Gewalt deutlich geworden, die sich seit Jahrzehnten wiederholen. Einige davon möchte ich in diesem Text ansprechen.
Worüber reden wir?
In meiner Wahrnehmung haken Debatten um das Thema geschlechterspezifische Gewalt zum Teil daran, dass nicht klar ist, worüber wir sprechen. Zum Beispiel: Geht es um einen einzigen Vorfall, in dem eine Person eine andere verbal belästigt, sich anschließend allerdings glaubhaft entschuldigt oder anderweitig erkennbar Mühe gibt? Oder geht es um einen wiederholt gewalttätigen Mann, der Frauen in Beziehungen isoliert und ihr Leben kontrolliert?
Der erste Fall hat vermutlich weniger negative Konsequenzen auf die Betroffene und auf politische Strukturen als der zweite. Beide Fälle erfordern deshalb unterschiedliche Maßnahmen im Nachhinein.
Der erste Fall lässt sich möglicherweise schnell auflösen, da der Täter selbst aktiv wird, um das Problem zu lösen, und dabei auf die betroffene Person eingeht. Wir müssen keine Konfrontationen planen, da er von selbst versucht, Verantwortung zu übernehmen, ohne die eigene Überforderung in den Vordergrund zu stellen. In einem solchen Fall bräuchte es möglicherweise keine Unterstützungsgruppe für die Betroffene. In einem solchen Fall würde es höchstwahrscheinlich nicht zu einem öffentlichen »Outing« des Täters kommen, um beispielsweise andere vor ihm zu warnen.
Im zweiten Fall ist es anders: Der »Vorfall« bezieht sich nicht auf eine Situation, sondern auf viele Situationen über eine längere Zeitspanne. Da sich Täter in unserem Beispiel selbst als Linke verstehen, müssen sie sich eine Geschichte zurechtlegen, warum sie nicht anders handeln können, als sie es tun. Meist ist dieser Grund eine Erzählung darüber, selbst Opfer zu sein. Diese Erzählung wird in der Gewaltbeziehung und Mitwissenden gegenüber als Rechtfertigung für die eigene Gewalttätigkeit angebracht.
Die meisten Täter waren tatsächlich irgendwann mal von Gewalt betroffen. Das können wir anerkennen, ohne uns von der Betroffenen zu entsolidarisieren und Gewalttaten zu verharmlosen.
Betroffene haben bei Übergriffen, die gewaltvoller sind und länger andauern, aus verschiedenen Gründen weniger Ressourcen als im ersten Beispiel. Psychisch sind sie in der Regel schwerer betroffen und unsicherer darin, die Gewalt auch als solche zu benennen. Das erscheint widersprüchlich, da die Gewalt heftiger in Erscheinung tritt als im ersten Beispiel. Betroffene in andauernden Gewaltbeziehungen werden mit der Zeit weniger selbstbewusst, fühlen sich zunehmend schuldig und schämen sich dafür, sich nicht wehren zu können. Da Betroffene durch den Täter oft isoliert werden, fehlt ihnen auch ein Umfeld, an das sie sich wenden könnten.
Linke Gruppen sind gegen Sexismus, haben aber ironischerweise oft weniger Strukturen als die meisten öffentlichen Einrichtungen, um mit Belästigung umzugehen.
In einem solchen Fall ist nicht davon auszugehen, dass der Täter eigenständig Verantwortung übernimmt, nachdem die Gewalt in einem größeren Rahmen offiziell bekannt wird. Er sieht sich meist selbst als Opfer – der eigenen Biografie, der Cancel Culture, eines vermeintlich strafenden Feminismus (auch wenn er vorher selten ein Wort über feministische Themen verloren hat).
Wenn wir uns nach einem Übergriff fragen, was Maßnahmen sein können, um Betroffene zu unterstützen, sollten wir also schauen: Über was reden wir eigentlich? Welches Ausmaß an Gewalt liegt vor? Welche Art von Unterstützung brauchen wir als Umfeld und betroffene Person? Ist es überhaupt sinnvoll, auf den Täter zuzugehen? Gibt es Ressourcen, sich einem Backlash etwa durch das Täterumfeld zu stellen?
Katholische Kirche lässt grüßen
Ein weiteres Problem ist, dass sich linke politische Gruppen zum Teil wenig von anderen Kontexten unterscheiden, in denen es über Jahre hinweg zu Übergriffen kommt.
Linke Gruppen sind zum Teil sehr hierarchisch strukturiert – zum Teil kreisen sie um wenige Personen, die seit Jahren Machtpositionen besetzen. Linke Gruppen sind außerdem zu einem gewissen Grad von der restlichen Gesellschaft abgeschnitten. Kritik an ihnen wird in und von den Gruppen abgewehrt. All das macht es Betroffenen schwerer, Übergriffe als solche zu erkennen und sich Unterstützung zu suchen – nicht zuletzt, weil es einen Ausschluss aus der Gruppe zur Folge haben könnte. Es behindert auch, dass Gruppen intern Übergriffe wirkungsvoll verhindern und beenden können.
Wenn wir auf Institutionen wie die katholische Kirche schauen, ist schnell klar, dass es unabhängige Strukturen braucht, die sich mit Gewaltprävention befassen, um etwas zu erreichen. Die große Mehrzahl linker Gruppen sind Orte von Subkultur, die sich in Opposition zur Mehrheitsgesellschaft sehen. Die meisten dieser Gruppen beschäftigen sich nicht hauptsächlich mit feministischen Themen, sind aber offiziell »gegen Sexismus«. Sie erscheinen damit als sichere Orte für Frauen, haben aber ironischerweise weniger Strukturen als die meisten öffentlichen Einrichtungen, um mit Sexismus und sexueller Belästigung umzugehen. In diesem Zusammenhang steht die Vielzahl an Übergriffen, die in den vergangenen Jahren öffentlich gemacht wurden.
Warum passiert da so wenig? Ein bekanntes Scheinargument ist, dass Strukturen gegen sexuelle Ausbeutung in linken Gruppen aufzubauen vom eigentlichen politischen Ziel ablenke. Ich würde sagen: Die sexuelle Gewalt in der linken Szene lenkt von anderen politischen Zielen ab.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass es mehr selbstorganisierten Austausch zwischen Personen gibt, auf die sich das männliche sexuelle Anspruchsdenken richtet. Das sind in der großen Mehrzahl heterosexuelle Frauen. Es braucht Orte, an denen sich potenziell und tatsächlich Betroffene austauschen können, sowie Strukturen, die darauf vorbereitet sind, Betroffene zu unterstützen bzw. Prävention in linken Gruppen zu betreiben.
Feministische Erlösungsfantasien
Zuletzt möchte ich darauf eingehen, wie der sehr verständliche Wunsch, als heterosexuelle Frau dem Patriarchat zu entkommen, ein Problem im Umgang mit sexueller Gewalt erzeugt.
Sexuelle Gewalt ist ein strukturelles Problem. Diesen Satz lesen wir oft. Was bedeutet er eigentlich? Dass sexuelle Gewalt ein strukturelles Problem ist, heißt unter anderem: Es gibt keine individuelle Lösung; nicht einzelne Betroffene können das System verändern. Das einzusehen bedeutet auch, sich klarzumachen, als Frau für immer eine potenziell Betroffene von sexueller Gewalt zu sein.
Die patriarchale Gesellschaft aber verspricht Frauen, dass sie von Gewalt verschont würden, wenn sie sich nur gut genug benehmen. Wenn sie keine Schlampen sind, dann finden sie den richtigen Mann, der sie beschützt. Wenn sie nicht so viel nörgeln, dann bleibt er auch und bringt mal den Müll raus. Dass das nicht funktioniert, haben wir zuletzt am Fall von Gisèle Pelicot sehen können.
Feministische heterosexuelle Frauen sitzen in der Falle, wenn sie längerfristig mit einem Mann zusammen sein wollen. Die eigenen politischen Einstellungen auch im Privaten konsequent umzusetzen, heißt, eventuell keinen Partner zu finden. Es bedeutet, möglicherweise den eigenen Kinderwunsch aufgeben zu müssen. Sich dagegen zu entscheiden, jegliche Art von Abwertung und Anspruchsdenken durch einen Mann zu akzeptieren, bedeutet andererseits, sich zu befreien. Es gibt viele Menschen, die sich nicht in den vermeintlich sicheren und privilegierten Hafen der Kleinfamilie retten können und trotzdem nicht allein dastehen.
Einzusehen, dass wir ein strukturelles Problem haben, heißt eben auch zu verstehen: Es liegt nicht nur an mir, ob ich einen guten Mann finde. Genauso wenig wie es an den anderen Frauen liegt, dass sie mit gewalttätigen Männern zusammen sind.
Viele queere Personen können die Trauer, dass es keine Erlösung in der Kleinfamilie gibt, mehr als gut verstehen. Sich von der eigenen Erziehung, eine Kleinfamilie gründen zu müssen, abzuwenden, ist nicht leicht, aber es gibt Wege, sich solidarisch anders zu organisieren. Queere Menschen sind gesellschaftlich schon lange von traditionellen Familienmodellen ausgeschlossen und darauf angewiesen, andere Wege zu finden, sich umeinander zu kümmern.
Hier könnten sich heterosexuelle Frauen etwas abschauen, um sich aus dem vermeintlichen Zwang zu befreien, mit Männern Beziehungen einzugehen, in denen sie unter anderem die Hauptlast an Sorgearbeit tragen werden. Einzusehen, dass es im Patriarchat kein Entkommen gibt, könnte heterosexuellen Frauen zu einer neuen Solidarität verhelfen, aus der größere Fürsorge-Strukturen entstehen als solche, die um Männer kreisen.
Was heißt das in Bezug auf den Umgang mit sexueller Gewalt in linken Gruppen? Ich denke, es wäre hilfreich, wenn linksradikale Frauen sich selbst befragen, ob sie sich zu stark an Männern orientieren, weil sie darauf hoffen, irgendwann die Auserwählte zu sein, die doch einen guten Mann, die eine Ausnahme gefunden oder sich zurecht erzogen hat. Wenn zumindest ein Teil der Energie, die in Dating und folgenden Ärger mit Männern in den Aufbau solidarischer Beziehungen unter Feministinnen, in Freundinnenschaft als Wahlfamilie, fließen würde, wäre es deutlich schwieriger, Betroffene von sexueller Gewalt zu vereinzeln und auszuschließen.