Neue Fahnen, alte Ordnung
Über die Fallstricke des Befreiungsnationalismus
Von Thorsten Mense
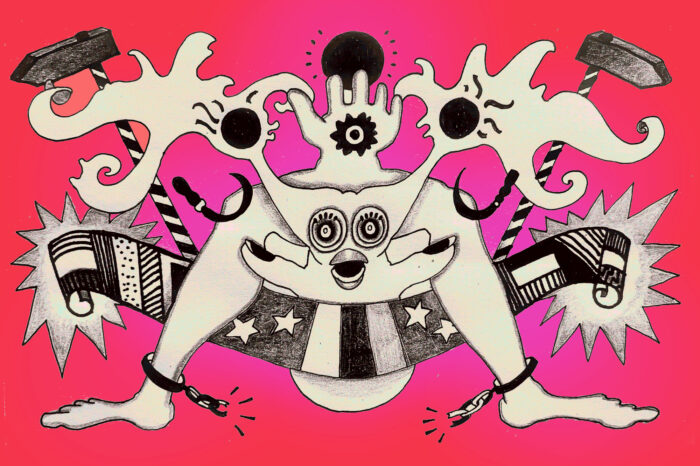
Malt den Nationalismus nicht rot an!« Ausgerechnet Lenin, der als großer Fürsprecher des »Selbstbestimmungsrechts der Völker« gilt, soll dies auf dem Kongress der Völker des Ostens 1920 in Baku den Vertreter*innen der antikolonialen Befreiungsbewegungen zugerufen haben.
Seine Skepsis war begründet, denn die Widersprüche zwischen einer emanzipatorischen Idee von Befreiung und Nationalismus auf der Hand: Denn Nationalismus ist die herrschende Ideologie zur Legitimation von Herrschaft und Ausgrenzung, von Imperialismus und Krieg. Als Kategorie der sozialen Grenzziehung schließt das Konzept der Nation die »Anderen« aus und diskriminiert sie. Als Zwangskollektiv, dem man bei Geburt zugeordnet wird, homogenisiert und unterwirft es die »Eigenen«, fordert von ihnen Anpassung, Loyalität und Opferbereitschaft. Nationale Identität schafft eine falsche Einheit, deckt die Risse der Klassengesellschaft zu und erschwert auf diese Weise, dass sich soziale Konflikte zu sozialen Kämpfen entwickeln. Hinzu kommt die enge ideologische Verknüpfung von Nationalismus mit Rassismus und Antisemitismus zur Bestimmung der Nation und Markierung ihrer Feind*innen. So gesehen scheint es offensichtlich, dass Nationalismus jeder Idee von Klassenkampf und Kosmopolitismus, also der Idee einer befreiten Weltgesellschaft, gegenübersteht.
Doch es gibt auch eine andere Geschichtsschreibung des Nationalismus, die von Befreiung und Revolution handelt: In seinem Namen wurden die Feudalherrschaft und der Absolutismus überwunden, er motivierte Partisan*innen in ganz Europa, sich dem deutschen Faschismus entgegenzustellen. Er war die vereinende Kraft in den antikolonialen Kämpfen, die das Ende des kolonialen Zeitalters herbeiführten, und in den nationalen Befreiungsbewegungen, die in Lateinamerika die Militärdiktaturen zu Fall brachten. Nicht Klassenbewusstsein, sondern Nationalbewusstsein schuf in den allermeisten Fällen die notwendige Einheit, mit der sich Menschen kollektiv gegen Unterdrückung und Gewaltherrschaft zur Wehr setzten.
Das Wesen der Nation
Dementsprechend ist der Begriff »Befreiungsnationalismus« irreführend. Denn jeder Nationalismus entsteht aus dem Gefühl heraus, unterdrückt zu werden und sich wehren zu müssen. Sei es früher gegen die absolutistische oder koloniale Herrschaft oder heute gegen eine angebliche »Überfremdung«: Der Kampf gegen eine (behauptete) Unterdrückung sagt erstmal nichts über den Charakter einer nationalistischen Bewegung aus. Auch die strikte Trennung eines linken Befreiungsnationalismus vom rechten oder bürgerlichen Nationalismus ist historisch nicht haltbar. Emanzipation und Unterdrückung, Fortschritt und Regression gingen von Beginn an in jedem Nationalismus zusammen. Und zwar notwendigerweise, denn Nationalismus schafft Solidarität durch Ausgrenzung, die kollektive Einforderung gleicher Rechte geht einher mit Verweigerung derselben Rechte gegenüber anderen Kollektiven. Das Konzept der Nation gründet auf der Vorstellung, dass es neben der eigenen noch andere Nationen gibt. So umfasst die Idee der Nation nie alle Menschen der Welt.
Zudem waren auch immer Teile der ansässigen Bevölkerung davon ausgeschlossen und mussten sich erst ihren Platz in der Nation erkämpfen. Die Ambivalenz des Befreiungsnationalismus zeigte sich eindrücklich in den lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die einerseits den Kontinent aus der kolonialen Abhängigkeit von Spanien führten, gleichzeitig aber das Ziel hatten, wie zum Beispiel der heute als Befreiungsheld verehrte Simón Bolívar betonte, Aufstände der schwarzen Sklavenbevölkerung, wie die soziale Revolution der »schwarzen Jakobiner« zuvor in Haiti, zu verhindern.
Emanzipation und Unterdrückung, Fortschritt und Regression gingen von Beginn an in jedem Nationalismus zusammen.
Befreiungsnationalismus wohnt aber vor allem ein Problem inne: Er wird, wenn er »erfolgreich« ist, zwangsläufig regressiv, da die Befreiung innerhalb der globalen kapitalistischen Ordnung nur eine begrenzte sein kann. Fast alle nationalen Befreiungskämpfe in Afrika, Lateinamerika sowie in großen Teilen Süd- und Südostasiens waren erfolgreich – von einer befreiten Gesellschaft sind diese Staaten dennoch ebenso weit entfernt wie der Rest der Welt. Hierfür ist nicht allein der nationale Charakter der Befreiungskämpfe verantwortlich, sondern ebenso der Kontext globaler sozialer Ungleichheit und neokolonialer Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Die Ursache für das – aus linker Perspektive – historische Scheitern des Konzeptes nationaler Befreiung liegt aber vor allem in ihm selbst begründet: Denn im globalisierten Kapitalismus gibt es keine wirkliche Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung. Ein Staat, der nicht an der Weltmarktkonkurrenz teilnimmt, ist nicht überlebensfähig – die Regeln der Teilnahme aber bestimmt nicht er und noch viel weniger seine Bevölkerung.
Uneingelöste Versprechen
So sind die Menschen nach dem Ende der konkreten Unterdrückung (sei sie feudaler, diktatorischer oder kolonialer Art) nun der abstrakten Herrschaft des Kapitals, dem stummen Zwang der Verhältnisse unterworfen. Sobald die Menschen merken, dass das Glücksversprechen uneingelöst bleibt, dass sie auch nach ihrer »Befreiung« weder frei noch gleich sind, gewinnen andere ideologische Erklärungsmuster an Bedeutung.
Frantz Fanon, der große antikoloniale Theoretiker, beobachtete dies direkt nach der ersten großen Welle der Dekolonisierung im »Afrika-Jahr« 1960, in dem 18 ehemalige Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangt hatten: »Dem Bauern, der immer noch in der Erde herumscharrt, dem Arbeitslosen, der immer noch arbeitslos ist, will es trotz den Nationalfesten, trotz den immerhin neuen Fahnen nicht gelingen, sich davon zu überzeugen, dass sich in seinem Leben wirklich etwas geändert hat. (…) Die Massen haben Hunger, und dass es heute afrikanische Polizeikommissare gibt, beruhigt sie nicht übermäßig.« Es findet ein »Rückfall in die Stammespositionen« statt, ein »erstaunlicher Triumph der ethnischen Gemeinschaften«, schreibt Fanon in »Die Verdammten dieser Erde«. Und weiter: »Vom Nationalismus sind wir zum Ultra-Nationalismus, zum Chauvinismus, zum Rassismus übergegangen. Man verlangt die Ausweisung dieser Ausländer, man verbrennt ihre Läden, man demoliert ihre Verkaufsstände, man lyncht sie.« Nationalismus verschwindet durch die nationale Befreiung nicht, sondern wird zur ausgrenzenden Praxis und chauvinistischen Integrationsideologie. Auf diese Weise reproduziert er die Verhältnisse, die er zu bekämpfen vorgibt. Hierin besteht die negative Dialektik der Befreiungsbewegungen.
Trotzdem war die Einrichtung eines bürgerlichen Nationalstaates angesichts der brutalen Gewalt der Kolonialherrschaft erstmal ein Fortschritt. Zudem blieb den kolonial unterdrückten Gesellschaften kaum etwas anderes übrig, als sich in den antikolonialen Kämpfen zur Nation zu erheben. Denn das Recht auf Selbstbestimmung und Souveränität gilt in der nationalstaatlich strukturierten Welt nur für Nationen. Heute aber ist die Zeit direkter Kolonialherrschaft vorbei. Herrschende und Beherrschte stehen sich in der Regel nicht mehr als Vertreter*innen verschiedener Nationen gegenüber, sondern Diskriminierung und Repression, Gewalt und Ausbeutung werden – als Bestandteil der erkämpften Souveränität – innerhalb der nationalen Gemeinschaft ausgeübt. So bekommt die Forderung nach nationaler Befreiung eine neue Bedeutung, denn es stellt sich die Frage, wer hier eigentlich von wem befreit werden soll.
Völker statt Klassen?
Damit kommt man zum zweiten großen Problem des Befreiungsnationalismus, wenn er außerhalb eines kolonialen Kontextes propagiert wird: es steht nicht Herrschaft an sich, sondern Fremdherrschaft im Fokus der Kritik. Da die Ursachen für die Misere nicht in der gesellschaftlichen Ordnung gesehen werden, muss jemand anderes dafür verantwortlich sein. So findet in fast allen aktuellen linken Nationalismen eine Ethnisierung der sozialen Klassen statt, mit der die Bourgeoisie aus der Nation ausgeschlossen und zu »Agenten des Imperialismus« erklärt wird. Die Anknüpfungspunkte für antisemitische Erklärungsmuster sind in dieser ethnisierten Herrschaftskritik bereits angelegt. Das Gewaltpotenzial solch eines homogenisierenden Volksbegriffes richtet sich ebenso nach innen. Heterogenität und gesellschaftliche Konflikte, soziale Ungleichheit und patriarchale Verhältnisse werden verschleiert und eingeebnet.
Jeder Vorstellung nationaler Einheit ist dieses repressive Moment zu eigen. Die Menschen werden nur noch als abstrakte Mitglieder ihrer Nation gesehen und ungefragt zu Angehörigen der »unterdrückten Völker« erklärt. Den Einzelnen, die vor Ort um ihre Befreiung gegen repressive Ordnungen und Strukturen kämpfen, wird dadurch die Solidarität versagt. Letztendlich steht das Selbstbestimmungsrecht der Völker der Selbstbestimmung des Individuums entgegen.
Diese Kritik ist nicht neu. Im Jahr 1991 veröffentlichten Teile der militanten Revolutionären Zellen (RZ), nachdem bekannt geworden war, dass das ehemalige RZ-Mitglied Gerd Albartus 1987 von einer »befreundeten« Gruppe des palästinensischen Widerstandes hingerichtet worden war, den Text »Gerd Albartus ist tot«. Er ist eine schonungslose Selbstkritik an der – lange Zeit auch von ihnen praktizierten – oftmals blinden internationalen Solidarität mit nationalen Befreiungsbewegungen. Darin heißt es: »Wem nützen wir damit, wenn wir unter dem Banner des Internationalismus eine falsche Einheit vorgaukeln, während hinter den Kulissen die Gegensätze aufeinanderprallen. (…) Die Beendigung der Fremdherrschaft, so dachten wir, sei gleichbedeutend mit dem Beginn der sozialen Revolution. Da die Befreiungsorganisationen das um seine Unabhängigkeit kämpfende Volk repräsentierten, waren sie der direkte Adressat internationaler Solidarität. Dass die Machtübernahme den sozialen Gehalt der Revolution in fast allen Fällen eher zerstörte als entfaltete, dass sich die Führer der Befreiungsbewegungen, kaum hatten sie die Kommandoposten in den jungen Nationalstaaten besetzt, als Protagonisten brutaler Entwicklungsdiktaturen gebärdeten, dass von der frisch gewonnenen Unabhängigkeit vor allem die alten Kader profitierten, während das anhaltende Massenelend einer neuen Erklärung bedurfte, dass sich – kurz gesprochen – die ganze Dialektik von nationaler und sozialer Befreiung vor allem für die neuen Machthaber rechnete und dass dies keine Frage von Verrat oder korrupter Moral war, sondern dem Wesen der Staatsgründung entsprach – all das passte nicht in unser Bild eines homogenen Befreiungsprozesses und wurde deshalb ausgeblendet.«
Auch über 30 Jahre danach hat diese Kritik nichts an ihrer Aktualität eingebüßt.
Thema in ak 706: Campismus & Befreiungsnationalismus
