Deutschland im Herbst 1992
Wenn Bürgerliche und Linke gemeinsam gegen rechts demonstrierten, gab es schon früher Probleme – ein Rückblick
Von Jens Renner
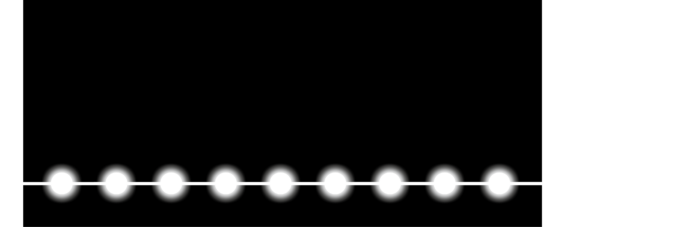
Das hatte sich der Bundespräsident ganz anders vorgestellt. Vor mehr als 300.000 Menschen wollte Richard von Weizsäcker (CDU), Sohn und Rechtsbeistand des verurteilten NS-Kriegsverbrechers Ernst von Weizsäcker, am 8. November 1992 in Berlin das »weltoffene und ausländerfreundliche Deutschland« preisen und sich dafür feiern lassen. Daraus wurde nichts.
Schon nach seinem ersten Satz ertönte ohrenbetäubender Lärm, auch Eier und Farbbeutel flogen. Ein zerschnittenes Mikrokabel machte den Rest seiner Ansprache weitgehend unhörbar. Dafür gesorgt hatten: »die Autonomen«. Weitere Redner*innen waren nicht vorgesehen. Veranstaltet wurde die Kundgebung vom Berliner Abgeordnetenhaus, Bundestag und Bundesrat.
In den folgenden Tagen lieferte die staatstragende Presse die Kernaussagen aus Weizsäckers Redemanuskript nach, darunter das Bekenntnis zur unantastbaren Würde des Menschen und die Aufforderung, »der Gewalt von rechts entgegen zu treten«. Zugleich aber, so die Mahnung des höchsten deutschen Amtsträgers, »haben wir die dringliche Pflicht, ein System zu schaffen, das die Zuwanderung steuert und begrenzt.«
Es stellte sich die Frage, wie mit ähnlichen Aktionen in Zukunft umzugehen sei? Wegbleiben? Hingehen?
Dass die Mehrheit der in Berlin Versammelten das gern gehört hätte, muss bezweifelt werden. Denn auf unzähligen Transparenten und in Sprechchören wurde auch das gesellschaftliche Umfeld thematisiert, das die rechte Terrorwelle begünstigte: die geplante Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, Hetze gegen »Asylmissbrauch« durch »Wirtschaftsflüchtlinge«, die Duldsamkeit des Staatsapparates gegenüber rassistischer Gewalt. Seit dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen waren erst wenige Wochen vergangen. Auch danach verübten Nazis fast täglich Anschläge auf Sammelunterkünfte von Migrant*innen.
Mediale Hysterie nach dem »Tag der Schande«
In der Berichterstattung über die »Weizsäcker-Demo« dominierte dennoch die Abgrenzung von den linksradikalen Eierwerfer*innen. Diese hätten den 8. November zum »Tag der Schande« gemacht, verlautbarte der Vorstand des Springer-Konzerns. Die ARD fantasierte von drohendem Bürgerkrieg, und die Berliner Zeitung empörte sich, das lobenswerte Engagement Hunderttausender sei »auf beschämende und bestürzende Weise von wenigen hundert Krawallmachern diskreditiert« worden. In der taz, die unmittelbar danach in den Chor der Entrüsteten eingestimmt hatte, wertete Christian Semler einen Tag später die Demo dagegen als Erfolg, auch weil die wenigen anwesenden Politiker*innen der großen Parteien »einen sehr unangenehmen Nachmittag zu überstehen hatten«. Weithin hörbar gescheitert war ihr Versuch, das durch den rechten Terror beschädigte Ansehen der europaweit ohnehin mit Argwohn betrachteten Berliner Republik aufzupolieren.
Diese Sichtweise wurde von großen Teilen der Linken geteilt und begrüßt. Allerdings war damit die innerlinke Debatte um die »Weizsäcker-Demo« nicht beendet. Denn es stellte sich die Frage, wie mit ähnlichen Aktionen in Zukunft umzugehen sei? Wegbleiben? Hingehen? Und wenn ja – den von den »Rassisten mit Krawatte« geplanten Ablauf stören und die Heuchler*innen am Reden hindern? Durch eigene Beiträge auf die für antirassistische Positionen potenziell gewinnbaren »Massen« argumentativ einwirken? Oder doch lieber auf Basis der »richtigen« Forderungen eigene, dann aber deutlich kleinere Aktionen organisieren?
In dieser Zeitung eröffnete der ak-Redakteur he. die Debatte mit dem Artikel »Einheitsfront und linke Bündnispolitik«. (ak 348, 19.11.1992) Er sah die Linke in Deutschland mit der neuen Erfahrung konfrontiert, »dass Menschen massenhaft gegen Rechtsradikalismus, Faschismus und Rassismus auf der Straße demonstrieren, ohne mit der herrschenden Ideologie gebrochen zu haben«. Klar sei aber, »dass mit den heute allein von der radikalen Linken zu erreichenden Menschen dem Rechtsradikalismus nicht entscheidend entgegenzutreten ist«. In einer Replik, die vier Wochen später erschien (ak 349, 16.12.1992), kritisierte M./Berlin an he.s Artikel »inhaltliches Wischiwaschi« und lobte die Störung der Berliner Kundgebung als wirksame Aktion gegen die »Herausbildung einer Volksgemeinschaft«. Was wiederum he. in seiner Antwort als »völlig verfehlt« zurückwies. Die Störaktionen, die er in seinem ersten Diskussionsbeitrag nicht explizit bewertet hatte, bezeichnete er nun als »reine Notwehr einer sich in der Defensive befindenden Linken«; das sei »kein kluger Schachzug« gewesen. (ak 350, 13.1.1993)
Ein Fernsehpreis für den »Laternenumzug«
Die These, es formiere sich gerade eine neue »Volksgemeinschaft«, war zur damaligen Zeit weit verbreitet, vor allem in der »antideutschen« Szene, die ehemalige KB-Minderheit (Gruppe K) eingeschlossen. Etwas vorsichtiger formulierte die Autonome l.u.p.u.s Gruppe: »Es gibt wieder einen Run auf das ›neue‹ Gemeinschaftsgefühl, das man früher ›Volksgemeinschaft‹ nannte und sicherlich im Rahmen der ›Normalisierung‹ der deutschen Geschichte bald wieder beim Namen nennen darf.« Der Satz findet sich in dem Buch »Lichterketten und andere Irrlichter«. Der Titel bezieht sich auf ein Phänomen, das ab dem 6. Dezember 1992 für Schlagzeilen sorgte.
An diesem Tag, zwei Wochen nach dem mörderischen Nazi-Anschlag von Mölln, formierte sich in München die mit 400.000 Teilnehmenden größte Demo gegen rechts. Initiiert wurde sie von der Inhaberin einer Werbeagentur und drei Männern aus dem Medien- und Kulturbereich, darunter der heutige Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. Das Motto der Veranstaltung lautete: »Eine Stadt sagt nein« – zu rechter Gewalt, nicht zum parteiübergreifend betriebenen Anschlag auf das Asylrecht. In München kam auch das drei Jahre zuvor an mehreren Orten der DDR praktizierte Mittel der Lichterketten (»Ein Licht für unser Land«) zum Einsatz. »Bringen Sie alles mit, was blinkt und leuchtet (Kerzen, Taschenlampen – bitte keine Fackeln)«, hieß es im Münchener Aufruf. Und weiter: »Die Lichterkette soll eine halbe Stunde lang stehen – eine ruhige halbe Stunde zum Nachdenken.« Dann sei Schluss. Das wurde auch befolgt und an diversen anderen Orten nachgespielt.
Den Publizisten Eike Geisel animierte das Münchener Lichtermeer zu gnadenloser Häme. In seinem taz-Artikel mit der Überschrift »Triumph des guten Willens« (in Anlehnung an Leni Riefenstahls Propagandafilm »Triumph des Willens« zum Nürnberger NSDAP-Parteitag von 1934) reihte Geisel diverse Anspielungen auf die nationalsozialistischen Massenaufmärsche aneinander: »Hauptstadt der Bewegtheit«, »brennender deutscher Gruß«, »Feldgottesdienst«, »neue Gleichschaltung« usw. Hohnworte wie »Laternenumzug«, »Adventsfeier«, »Betroffenheitsgala«, »moralische Glühwürmchen« und »überfälliges Begräbnisritual des politischen Protests« wirkten da vergleichsweise niedlich.
Die Organisator*innen der Münchner Lichterkette mussten sich deswegen nicht grämen. Vier Tage nach dem Spektakel wurde ihnen der »Sonder-Bambi« verliehen, ein Medien- und Fernsehpreis des Konzerns Hubert Burda Media. Auch mit der Ehrung »München leuchtet« der Stadt München wurden sie ausgezeichnet.
Bilanz der »Kerzendemos«
Anfang Januar 1993 bilanzierten zwei Genossen des Kommunistischen Bundes (KB) in Nürnberg, der die Auflösung des bundesweiten KB zwei Jahre zuvor überlebt hatte, die Demos der vergangenen Wochen. Unter der einprägsamen Überschrift »Mit Lichterketten gegen Nazis weizsäckern?« formulierten sie ein »Plädoyer für eine massenorientierte antirassistische Arbeit der Linken, die Weizsäcker nicht auf den Leim geht«. (ak 350, 13.1.1993) Bei den »Kerzendemos« handele es sich »selbstverständlich um keine linke Bewegung«. Dennoch sollte diese »nicht abschätzig rechts liegen gelassen werden (…). Es wäre eigentlich die Aufgabe der Linken, auch mit ihren bescheidenen Kräften in diese verwackelte Szene vor allem mit dem Artikel-16-Thema (der geplanten Abschaffung des Asylrechts; Anm. ak) und der Forderung nach Gleichberechtigung der Nicht-Deutschen im umfassenden Sinn hineinzugehen.«
Richtig lagen die Nürnberger mit ihrer Vermutung, dass »die Kerzenaktionen in dieser Form und Breite nicht sehr oft wiederholbar« sein würden. Gegen die Demontage des Asylrechts demonstrierten am 26. Mai 1993, dem Tag der Bundestagsabstimmung über den »Asylkompromiss«, in Bonn nur etwa 10.000 Menschen. Sie taten das allerdings nicht mit Kerzen, sondern indem sie die Zugänge zum Bundestag blockierten und den Verkehr in der Stadt weitgehend lahmlegten. 260 Abgeordnete erreichten das Parlament per Schiff, 130 wurden mit Hubschraubern eingeflogen. Natürlich konnte die militante Massenaktion die Abschaffung des Asylartikels 16/2 Grundgesetz nicht verhindern. Die Lichterketten-Bewegung allerdings hatte das nicht einmal versucht.
