Kapitalismus auf Chinesisch
Wie diskutiert die deutsche Linke die ökonomische Entwicklung?
Von Renate Dillmann
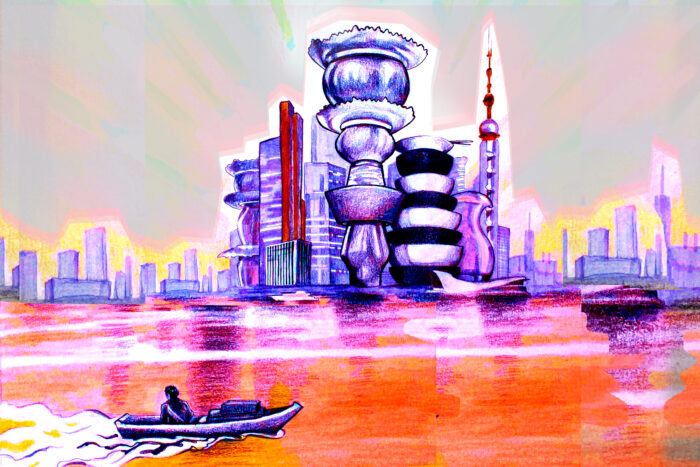
Dass das heutige China ein kapitalistisches Land ist – dem würden sicher viele zustimmen. Was aber bedeutet das? Die erste Antwort darauf lautet, vielleicht etwas ungewöhnlich für ein linkes Publikum: Chines*innen sind frei. Frei von den früher üblichen Vorschriften ihrer kommunistischen Staatspartei, den von oben angeordneten »Massenkampagnen«; inzwischen auch ziemlich frei in der Wahl ihrer Wohn- und Arbeitsorte. Sie können sich heute auch so gut wie alles kaufen, die Mangelwirtschaft der sozialistischen Etappe ist längst überwunden. Allerdings müssen sie dafür – kein bisschen anders als bei uns – selbstverständlich Geld haben. Geld, um sich das Lebensnotwendige kaufen zu können.
Dieses Geld muss man irgendwie verdienen. Die chinesischen Menschen haben dafür prinzipiell drei Möglichkeiten: Sie verdienen es auf dem Land, auf einer kleinen Parzelle mit harter Feldarbeit; das gilt immer noch für etwa 330 Millionen Menschen. Oder sie suchen sich eine Arbeit, oftmals weit weg von der ländlichen Heimat, in einer der vielen Millionenstädte. Dabei ist klar: Eine solche Arbeitsstelle findet sich nur, wenn ein Unternehmen seinen Gewinn damit macht – und entsprechend sehen die Bedingungen dieser Arbeit aus: Wer Glück hat und eine findet, darf lange arbeiten und kriegt wenig Geld. Selbst wenn man die sogenannten Exzesse dieser Arbeitsverhältnisse, wie sie von Foxconn und anderen Firmen bekannt sind, beiseite lässt: Das Prinzip gilt – und es gilt auch für erheblich besser bezahlte Jobs.
Arbeit findet in China als Lohnarbeit statt, und das bedeutet wie überall auf der Welt: Sie ist nicht das Mittel derjenigen, die arbeiten und den Reichtum ihrer Gesellschaft produzieren, sondern sie ist das Mittel derer, die mit ihrem Geld diese Arbeit kommandieren, um selbst reicher zu werden. Das ist nämlich die dritte Möglichkeit, Geld zu verdienen: Wer dazu in der Lage ist, lässt andere für sich arbeiten – das ist im heutigen China wie überall sonst im globalisierten Kapitalismus die schönste Einkommensquelle.
Die Vorstellung von schlimmen und weniger schlimmen kapitalistischen Staaten führt in die Irre.
In China kann man den Beginn der Wende zum Kapitalismus genau datieren: Es war die Entscheidung der Kommunistischen Partei unter der Führung von Deng Xiao Ping 1978 – zwei Jahre nach Maos Tod –, ihre bisherige sozialistische Planwirtschaft zu »reformieren« bzw. »transformieren«, weil sie sich von der Einführung »kapitalistischer Methoden« eine schnellere Entwicklung des Landes und den Wiederaufstieg der chinesischen Nation erhoffte. Von diesem Standpunkt aus – also dem der chinesischen Nation – ist das »kapitalistische Experiment« erfolgreich verlaufen.
Was die Einführung des Kapitalismus für die chinesischen Lohnabhängigen bedeutet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sie arbeiten sich an der von ihrer Staatspartei etablierten Konkurrenz um Geld als ihrer neuen Lebensgrundlage ab – ob sie diese gewollt haben oder nicht, spielt dabei keine Rolle, ebensowenig, wie sie damit zurechtkommen. Ihr Land aber hat sich mit ihrer produktiven Ausbeutung zur ökonomischen Supermacht entwickelt und tritt den etablierten Nutznießern des kapitalistischen Weltmarkts inzwischen auch politisch auf Augenhöhe gegenüber.
Im Unterschied zur Sowjetunion, in der die Wende zum Kapitalismus einen enormen Zerfall von Ökonomie und Staat hervorgebracht hat, ist der enorme Erfolg der Volksrepublik darauf zurückzuführen, dass der chinesische Staat die »Transformation« nicht als Rückzug des Staats begriffen und einer privaten Aneignung der ökonomischen Ressourcen durch die aufkommenden »Oligarchen« überantwortet hat, sondern dass er sie politisch stark beaufsichtigt und, wenn nötig, modifiziert hat; die Stichworte dazu sind etwa reglementierte Sonderwirtschaftszonen, Aufbau konkurrenzfähiger chinesischer Unternehmen und das globale Infrastrukturprogramm Neue Seidenstraße. Inzwischen gehört dazu übrigens auch der Aufbau einer Sozialversicherung nach deutschem Vorbild. – ein Beitrag zur Nachhaltigkeit einer produktiven Ausbeutung und zum »sozialen Frieden«.
Besonders üble Ausbeutung?
Viele deutsche Linke finden dieses China ganz besonders »schlimm« – schlimmer als ihren heimatlichen Staat, an dem sie ja auch einiges auszusetzen haben. Sie werfen dem chinesischen Kapitalismus besonders üble Ausbeutungspraktiken vor, dem chinesischen Staat sein besonders autoritäres und repressives Vorgehen (Stichworte meistens Meinungs- und Pressefreiheit) und deuten auf Hongkong bzw. die Uiguren. Ich kann diese Vorwürfe hier nicht im einzelnen behandeln – will aber zumindest eine allgemeine methodische Überlegung dazu anstellen.
Die Vorwürfe, vielfach erhoben in Kreisen linker Aktivist*innen, leben meist von einem Vergleich: In China ist das und das schlimmer als hier. Das »das und das« kommt dann allerdings gar nicht mehr vor. Kapitalistische Wirtschaft, Ausbeutung und staatliche Herrschaft sind gar nicht mehr befassungswürdig, sondern nur noch, dass all das »in China« noch schlimmer ist. Die eigentlich fällige Frage, warum das so ist, kommt seltsamerweise nicht auf. Sind chinesische Unternehmer von Natur aus habgieriger als unsere? Sind chinesische Politiker per se autoritärer, machtversessener als unsere? An jedem Punkt könnte auffallen, dass es sich so vermutlich nicht verhalten kann. Zumal die chinesische Ausbeutung ganz massiv von westlichen Unternehmen mitgetragen wird – Unternehmen, die übrigens von der chinesischen Regierung vorgesehene arbeitsrechtliche Einschränkungen ablehnen und umgekehrt hier mit dem Verweis auf China Löhne und Arbeitszeiten zu ihren Gunsten ummodeln.
Wenn man allerdings nichts davon wissen will, was die Einführung des Kapitalismus in ein ehemals sozialistisches Land eigentlich bedeutet, etwa was die Etablierung der Konkurrenz um Eigentum an sozialen Gegensätzen aufwirft, die staatliche Gewalt erforderlich machen; wenn man nichts davon wissen will, dass der Einstieg eines solchen Landes in die ja längst fertige Weltmarktkonkurrenz heißt, dass die besondere Billigkeit der Lohnarbeit das einzige Mittel in dieser Konkurrenz ist, wenn das Land nicht über Öl und Gas verfügt; wenn man all das ignoriert, dann nimmt man die Konsequenzen natürlich weniger wahr als die üblen Notwendigkeiten einer solchen Ökonomie und des Staats, der sie zu seinem Nutzen erfolgreich machen will. Dann sieht man das als besondere Perfidie Chinas, kritisiert also nicht das System, sondern hat ein – in dem Fall – linkes Feindbild. Übrigens: Diese Art linker China-Kritik ist ziemlich empfänglich dafür, von einer aggressiven deutschen Außenpolitik, die gerne im Namen der Menschenrechte operiert, instrumentalisiert zu werden!
Mit aufklärenden Informationen gegen ein Feindbild antreten zu wollen, funktioniert nicht.
Es gibt allerdings auch ein Bild von China, das wesentlich freundlicher, aber nicht unbedingt sachlicher bzw. richtiger ist. Dessen Vertreter, z.B. Helmut Peters, Wolfram Adolphi oder Marcel Kunstmann, schenken der Kommunistischen Partei und ihren Interpretationen Glauben, denen zufolge sich das Land noch immer auf dem Weg zum Sozialismus befindet – nur dass dieser etwas länger ausfällt als angenommen und kleine kapitalistische Umwege zur Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivkraft einschließt. Wenn das stimmen würde, müsste Chinas Regierung übrigens spätestens jetzt konstatieren, dass dieses Ziel erreicht ist und man nun – nach Jahrzehnten der Schinderei für die vom Lohn Abhängigen – mit einem Leben in Versorgung, Sicherheit und Genuss anfangen könnte. Stattdessen setzt die KP auf die Tagesordnung, bis 2049, dem 100. Geburtstag der Volksrepublik, »weltweit führende Produktionsmacht« zu sein. Das ist schon ein kleiner Unterschied!
Das Urteil dieser Autoren verweist darauf, dass sie sich unter Sozialismus offenbar dasselbe vorstellen wie Christian Lindner (nur dass für den ein Albtraum ist, was sie gut finden): Sozialismus ist, wenn ein Staat sich dirigistisch in die Wirtschaft einmischt. Das Interesse, das dieser Sicht auf China zugrunde liegt, wird dabei meist ziemlich offenherzig ausgesprochen: Man ist schlicht und einfach froh, dass es überhaupt noch einen Staat gibt, der sich kommunistisch nennt – da ist es fast schon egal, was das bedeutet. Und man meint zumindest außenpolitisch einen antihegemonialen Hoffnungsträger ausfindig gemacht zu haben – dafür macht man dann ohne großes Federlesen aus Chinas staatlich beaufsichtigten Konkurrenzanstrengungen auf dem Weltmarkt eine angebliche Alternative zur amerikanischen Dominanz.
Daneben schreiben Autoren wie Jörg Kronauer, Uwe Behrens oder Wolfram Elsner gegen das deutsche »Feindbild China« an. Die Aussagen dieser teilweise durchaus informativen Publikationen: China macht »gutes Regieren«, clevere Wirtschaftspolitik, es bekämpft Armut, baut einen Sozialstaat auf, geht gegen seine früheren Umweltsünden vor, fördert E-Mobilität und Aufforstung, ist also ein ökologisch verhältnismäßig vorbildlicher Staat, in seiner Außen- und Entwicklungspolitik ist es zwar egoistisch, aber nicht aggressiv, es rüstet auf, aber defensiv.
Jenseits von Gut und Böse
Allerdings: Mit aufklärenden Informationen gegen ein Feindbild antreten zu wollen, funktioniert nicht. Das liegt daran, dass die Verurteilung gar nicht an mangelndem Vorwissen liegt. Einen deutschen Patrioten, dem der Aufstieg Chinas Sorgen macht und der die Gefährlichkeit dieser Nation an allem, was ihm vor die Flinte kommt, bebildert, wird man mit den genannten Argumenten nicht beruhigen. Man muss schon die Logik des Feindbilds angreifen: der wie selbstverständlich in »unseren« Werten und Institutionen liegende Maßstab des guten Regierens per westlicher Demokratie, letztendlich die Menschenrechte als Geschäftsordnung einer kapitalistischen Welt. Und es gehört auch dazu, den geistigen Ursprung in der Loyalität zur eigenen Nation und deren Interessen aufzufinden.
Die Vorstellung von »schlimmen« und »weniger schlimmen« kapitalistischen Unternehmen oder Staaten führt zu geistigen Irrwegen. Es ist vielmehr das eine und unteilbare Sachgesetz der kapitalistischen Konkurrenz, das bei den verschiedenen nationalen Standorten zu unterschiedlichen Konsequenzen führt.
Wer begreifen will, warum es den westlichen Staaten unter US-Führung demnächst wahrscheinlich einen Weltkrieg wert sein wird, China am Aufstieg zur Weltmacht zu hindern, der sollte sich freimachen von dieser Art Vergleichen. Zu der anstehenden Auseinandersetzung passt die Feindseligkeit von Teilen der deutschen Linken andererseits recht gut: Sie bezeugt von dieser, im Prinzip unmaßgeblichen Seite her, dass das bisher unangefochtene Weltgewaltmonopol mit seiner »wertebasierten Außenpolitik« auch noch die Moral für sich in Anspruch nehmen kann.
