Auf einen Nenner gebracht
Angezählt im Kapitalismus: wie die Mathematik in die Wirtschaftswissenschaften kam und die Verhältnisse mystifiziert
Von Ingo Stützle
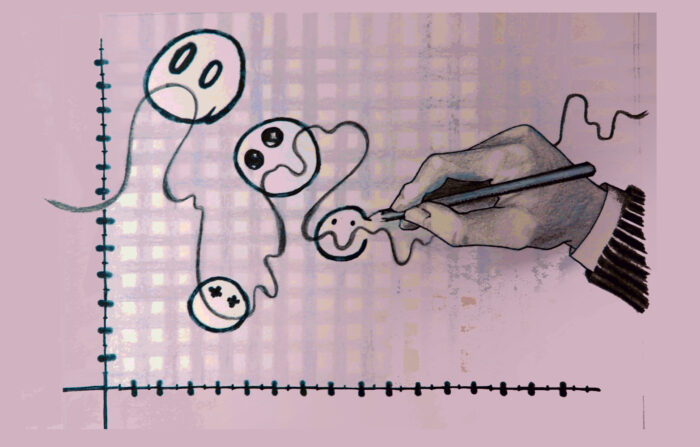
Wenn jeder Mensch auf eine Zahl reduziert wird, kann das Unternehmen niemals die ganze Person sehen«, heißt es im Harvard Business manager (7/2022, S. 28), womit das Magazin eine gängige Kritik formuliert, warum der Kapitalismus unmenschlich ist, nämlich, dass von all dem, was einen Menschen ausmacht, abstrahiert wird und am Ende nur eine Zahl übrig bleibt. Ein Businessmagazin hat selbstredend keine Gesellschaftskritik im Sinn. Wer diese jedoch formuliert, kommt nicht umhin, auch die Wirtschaftswissenschaften zu kritisieren, die beanspruchen, die herrschende Wirtschaftsweise zu verstehen.
Nicht ohne Grund trägt Marx’ Hauptwerk »Das Kapital« den Untertitel »Kritik der Politischen Ökonomie«, womit der Kapitalismus und die Wissenschaft gemeint sind. Und die Disziplin, selbst die Strömungen, die sich als »heterodox«, also nicht dem Mainstream folgend, verstehen, zeichnen sich heute durch Mathematik aus: Formeln, Gleichungssystem, Kurven und Matrizen. In einem verhältnismäßig weit verbreiteten heterodoxen VWL-Lehrbuch heißt es: »Es gibt Vertreter in der Zunft der Volkswirte, die davon ausgehen, dass erst mit der Einführung der Mathematik die Volkswirtschaftslehre zur Wissenschaft geworden ist und theoretische Aspekte, die nicht mathematisch formulierbar sind, in der Volkswirtschaftslehre keinen Platz haben sollten.«
Die marginalistische Revolution
Mathematik fasste erst im 19. Jahrhundert Fuß in den Wirtschaftswissenschaften, während aus political economy die Selbstbezeichnung economics wurde, und mauserte sich zur tonangebenden wissenschaftlichen Methode. Das lässt sich anhand der Verwendung in Fachzeitschriften aufzeigen. So wurden 1930 in zehn Prozent der Beiträge in den Fachzeitschriften Economic Journal und American Economic Review Formeln verwendet, während es 50 Jahre später bereits 75 Prozent waren. Im Jahr 1892 wurden in 95 Prozent aller Artikel in den vier führenden Wirtschaftszeitschriften weder geometrische Darstellungen noch Formeln verwendet, während etwa hundert Jahre später sich das Verhältnis umgedreht hatte.
Dieser Prozess ging mit der sogenannten marginalistischen Revolution einher, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vollzog und die neue Fragestellungen etablierte. Die gesellschaftliche Konfliktlinie war nicht mehr die zwischen grundbesitzendem Feudaladel und industriellem Kapital, wie zur Zeit der ökonomischen Klassik (von William Petty bis David Ricardo), sondern der Kapitalismus hatte sich bereits etabliert und die zentrale Konfliktlinie war nunmehr die zwischen Lohnarbeit und Kapital – zwischen formal Freien und Gleichen, die gleichermaßen nach Glück streben.
Der neue Klassenkonflikt kippte auch ein zentrales Theorem der damals herrschenden Lehre. Während bis in die 1860er Jahre davon ausgegangen worden war, dass für Löhne ein begrenzter Fonds des gesellschaftlichen Reichtums zur Verfügung stehe, der nicht vergrößert, nur anders aufgeteilt werden könne, musste dieses Theorem aufgrund von Erfolgen der Arbeiter*innenklasse aufgegeben werden: Die Löhne stiegen, ohne dass die Arbeitslosigkeit wuchs. Es wurde daraufhin die Flucht nach vorne angetreten und anerkannt, dass die Distributionsverhältnisse gesellschaftlich veränderbar sind; die Produktionsverhältnisse seien jedoch Ausdruck technischer Notwendigkeiten und damit unveränderlich.
Das Marginalprinzip stellte für die Politische Ökonomie die Brücke zur Mathematik her.
Hinzu kamen die Attacken auf die sogenannte Arbeitswerttheorie, die zunehmend Sozialist*innen für sich in Anspruch nahmen, um ihr Anrecht auf das ganze Arbeitsprodukt zu begründen. Der Wirtschaftshistoriker Mark Blaug resümiert hier: »Es ist bezeichnend, dass die Autoren, die die Ansichten der ›Arbeitstheoretiker‹ angriffen (…) auch unter den ersten waren, die die Abstinenztheorie des Profits hervorbrachten (d.h. dass Profit auf Sparen zurückgehe; ISt.). In diesem Sinne waren die theoretischen Neuschöpfungen dieser ›vernachlässigten britischen Ökonomen‹ nicht ohne Beziehung zu der Natur des Klassenkampfes nach 1830.«
Mit diesen und anderen Verschiebungen stand nicht mehr die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums im Zentrum, sondern wie Individuen ihre Bedürfnisse maximal befriedigen – und alle ihren gerechten Anteil vom Kuchen bekommen. Diese Verschiebung brachte einen neuen ökonomischen Wertbegriff hervor. Der unterschiedliche Wert der Produkte wurde fortan aus dem Grenznutzen (deshalb: marginalistisch) erklärt, also dem Nutzenzuwachs, den jede zusätzliche Einheit im Verhältnis zur vorherig konsumierten zeitigt. Für das erste Bier mag ich noch bereit sein, viel auf den Tisch zu legen, für alle weiteren weniger.
Formalisierung der Ökonomie
Nachdem die Differenzialrechnung Teil der höheren Schulbildung wurde, war diese auch für Ökonom*innen anwendbar. Das Marginalprinzip wiederum stellte für die Politische Ökonomie die Brücke zur Mathematik her. Die Konzeption des Grenznutzens lässt sich mathematisch wie viele Naturgesetze darstellen.
Diese Konzeption von Francis Edgeworth (1845-1926) griff Vilfredo Pareto (1848-1923) auf und entwickelte die noch verwendete Definition eines (gesellschaftlichen) Optimums: ein Zustand bei dem keine*r besser gestellt werden kann, ohne mindestens eine*n schlechter zu stellen (Pareto-Prinzip). Diese Kurvengrafiken lassen sich auch als mathematische Funktion darstellen, etwas, das man in der Schule in der Sekundarstufe nahegebracht bekommt.
Der Wissenschaftshistoriker Philip Mirowski zeigte auf, wie Ökonom*innen bewusst die Physik für sich in Anspruch genommen haben, um ihre Wissenschaft auszubuchstabieren bzw. besser: zu formalisieren. Es wurden nicht einfach physikalische Metaphern verwendet, sondern die »Naturgesetze« waren das Vorbild, um ökonomische Gesetzmäßigkeiten zu formalisieren. Das gilt für zentrale Vertreter der Disziplin. »Ökonomische Wahrheiten«, so etwa Alfred Marshall (1842-1924), seien »so eindeutig wie die Geometrie«; Politische Ökonomie sei »Mechanik des Nutzens und des Eigeninteresses«, meinte William S. Jevons (1835-1882) bzw. eine »mathematisch-physische Wissenschaft«, so Léon Walras (1834-1910).
Im weiteren Verlauf wurde diese Modellierung auf nahezu alle Bereiche der Wirtschaft übertragen. Mit Pareto verzichtete man schließlich ganz auf den Rückgriff auf Nutzen und skalierte nur noch Präferenzen. Ohne es offen auszusprechen war die erste Generation der Grenznutzentheorie nämlich in eine Sackgasse geraten: Es ist unmöglich, subjektiven Nutzen intersubjektiv zu messen und zu vergleichen. Jevons behauptete zwar, dass seine Wissenschaft mathematisch sein müsse, allein aus dem einfachen Grund, weil sie mit Quantitäten arbeitet – welche Qualität diese Größen jedoch sind und warum sie vergleichbar und deshalb miteinander »verrechenbar« sein sollten, darüber schwieg er sich aus.
Ein neues begriffliches Koordinatensystem
Marx kritisiert, dass moderne Kategorien der Politische Ökonomie wie Geld, Ware und Kapital als natürliche Gegebenheiten menschlichen Lebens erscheinen und eben nicht als das erkannt und verhandelt werden, was sie sind: historisch-spezifische soziale Verhältnisse. Mit der Neoklassik als dominante Wirtschaftstheorie findet eine Naturalisierung zweiter Ordnung statt. Menschen werden nicht nur zum nutzenmaximierenden Individuum erklärt, kapitalistische Logik als Menschennatur festgeschrieben, sondern mit der mathematischen Modellierung und Formalisierung findet eine weitere Versachlichung sozialer Verhältnisse statt, indem die Kategorien der Politischen Ökonomie in mathematische Modelle gebannt werden, wo vermeintlich nur noch mathematische Gesetzmäßigkeiten gelten. Das zeigt sich etwa für den Gebrauch von Produktionsmittel, in den mathematischen Modellen der Neoklassik »Produktionsfunktion« genannt. Diese soll den maximalen Ertrag ermitteln, d.h. den bestmöglichen Einsatz von Produktionsmittel. Profit und Privateigentum an Produktionsmitteln ist somit nichts Gesellschaftliches, historisch-spezifisches, sondern als inhärente Logik dem mathematischen Modell eingeschrieben.
Das müsste nun an vielen konkreten Beispielen einmal aufgezeigt werden. Hier bleibt nur eine Anekdote des Soziologen Leo Kofler anzuführen, die er einmal in einer seiner Vorlesungen anbrachte: »Wenn sie hören, die Preise steigen, glauben sie es nicht! Die Preise tun nämlich gar nichts!«
Das mathematische Auftreten trägt jedoch nicht nur dazu bei, gesellschaftliche Verhältnisse zu naturalisieren, sondern erleichtert es auch, über innertheoretische Probleme hinwegzugehen, da die eigenen Prämissen der Funktionen kaum reflektiert werden. So sind makroökonomische Aussagen neoklassischer Kurvenkonstruktion nur dann haltbar, wenn eine Ein-Gut-Welt unterstellt wird. Das ist jedoch eine völlig unrealistische Annahme – zumal in der Neoklassik von einer zentralen Kategorie abstrahiert wird: Geld.
Die Neoklassik ist selbst auf Grundlage eigener Prämissen nicht in der Lage, Aussagen etwa über den Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Beschäftigung, oder Profitrate bzw. Zinssatz und Kapitalbestand oder über die Verteilung des Volkseinkommens zu machen. Obwohl das seit den 1960er Jahren selbst von einigen Neoklassiker*innen eingestanden wird, sitzen ihre Vertreter*innen noch immer fest im Sattel. Da ist die Physik weiter, denn hier haben sich theoretische Konzeptionen weiterentwickelt. So hat Albert Einstein mit Isaac Newtons Konzept der Gravitationskraft aufgeräumt.
Im Feld der Politischen Ökonomie scheint das weitaus schwieriger zu sein, das begriffliche Koordinatensystem zu transformieren – trotz der Inkonsistenz der neoklassischen Lehre und ihrer mathematischen Modellwelt. Das liegt unter anderem daran, dass sie mit all dem weitaus stärker verwoben ist, was den Kapitalismus als Klassengesellschaft ausmacht. Wie im 19. Jahrhundert wird sich also hier wohl erst wieder etwas bewegen, wenn Klassenkämpfe dazu zwingen, andere Fragen zu stellen.
