Kriegstüchtiges Gesundheitssystem
Bundeswehr und Regierung wollen die Krankenhäuser auf den Konfliktfall ausrichten. Ein Einspruch aus der Ärzt*innenschaft
Von Elin Kreft und Pola Rausch
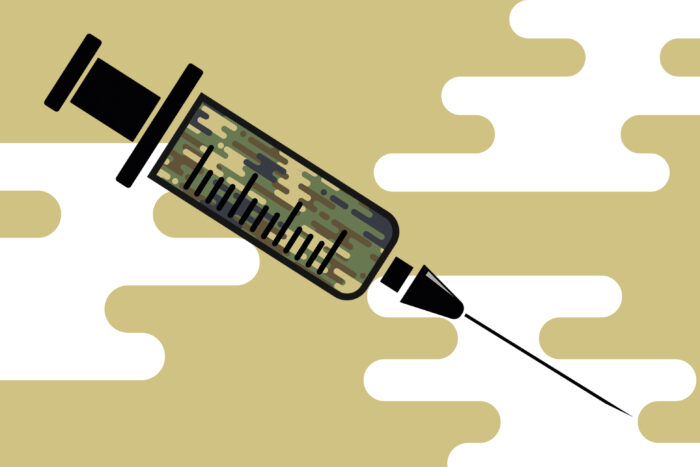
Wir machen es den angehenden Sanitätsoffizieren und Medizinstudenten nicht leicht. (…) Wenn wir Kinder-, Frauengeschrei oder Schussgeräusche einspielen, kann dies den ein oder anderen komplett aus der Bahn werfen. Das alles machen wir, um die Prüflinge so gut es geht auf die Realität vorzubereiten.« So wird der Ausbilder eines Sanitätsregimentes auf der Website der Bundeswehr zum gemeinsamen Training von Soldat*innen und Medizinstudierenden im Rahmen des Wahlpflichtfachs »Einsatz- und Katastrophenmedizin« an der Charité Berlin zitiert. Auf welche Realität sich die jungen Studierenden vorbereiten sollen, wird nicht näher benannt.
Im deutschen Gesundheitssystem wird unter dem Label »Zivil-Militärische Zusammenarbeit« immer häufiger Krieg gespielt. Im Rahmen der Zeitenwende, die 2022 von Olaf Scholz ausgerufen wurde, soll auch das deutsche Gesundheitswesen »kriegstauglich« gemacht werden. Auf Kongressen, etwa bei einem Symposium mehrerer Ärzt*innenkammern und der Bundeswehr mit dem Titel »Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?« in Hessen im September 2024 bedienten sich die Militärs einem Wort aus der Coaching-Szene und forderten, dass sich das »Mindset« der deutschen Gesellschaft ändern müsse. Dabei solle dem Gesundheitswesen eine wichtige Rolle zukommen, um die »Resilienz« Deutschlands im Kriegsfall zu erhöhen. Die willige Zusammenarbeit der Ärzt*innenorganisationen mit den Streitkräften etwa bei der Ausrichtung solcher Tagungen zeigt sich auch in der Ausgabe des Hessischen Ärzteblatts vom November 2024, das einen Panzer (beziehungsweise laut Bildunterschrift ein »geschütztes Mehrzweckfahrzeug«) auf dem Titelbild zeigt.
Die Interessen von Zivilbevölkerung und Militär sind nicht deckungsgleich.
Dabei werden gerne im Begriff »Katastrophenmedizin« Pandemien, Naturkatastrophen und Kriege vermischt, ganz so, als wäre es aus medizinischer Sicht irrelevant, was hinter einem »Großschadensereignis« steht. Der Expert*innenrat »Gesundheit und Resilienz« etwa, der aus dem Corona-Expert*innenrat hervorgegangen ist, befasst sich mit »zukünftigen Herausforderungen«: Neben Pandemien, Naturkatastrophen und Terroranschlägen wird auch der »Kriegs- oder Bündnisfall« dazugezählt.
Gesundheit als Verteidigung
Am 5. Juni 2024 verabschiedete das Bundeskabinett unter Federführung des Bundesinnenministeriums die »Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung«. Diese sieht auch eine weitreichende Einbindung des zivilen Gesundheitssystems unter Führung der Bundeswehr vor. Im März hat Gesundheitsminister Lauterbach noch ein Gesundheitssicherstellungsgesetz angekündigt, aus dem wegen des Endes der Regierungskoalition aber erst mal nichts wird. Es soll aber in der neuen Legislaturperiode wieder aufgegriffen werden. Das Gesetz soll die medizinische Versorgung im Katastrophen- und Kriegsfall regeln. Das letzte Referent*innenentwurf für ein Gesundheitssicherstellungsgesetz in den 1980er Jahren führte damals zu einer erheblichen Mobilisierung der deutsche Sektion der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs – Ärzt*innen in sozialer Verantwortung (IPPNW), deren Widerstand das Gesetz verhindern konnte. Leider ist von einem solchen Widerstand momentan nicht viel zu spüren.
Es ist höchste Zeit, dass sich Ärzt*innen, aber auch alle anderen Gesundheitsberufe wie Pflegekräfte, Apotheker*innen, Logistiker*innen und Sanitäter*innen kritisch mit der Rolle auseinandersetzen, die im Bündnis- oder Kriegsfall für sie vorgesehen ist. Die Illusion, die wir der deutschen Bevölkerung vermittelt sollen, ist klar: Wir haben alles im Griff, wir sind kriegsbereit, wir werden euch im Kriegsfall versorgen, retten und schützen können. Ganz unabhängig von den Feinheiten der Kriegsmedizin, die nun erlernt werden sollen, ist es schlicht nicht möglich, Menschen durch medizinische Maßnahmen vor den schrecklichen Folgen eines Krieges zu schützen. Keine Dekontaminationsübung wird verhindern, dass Zigtausende Menschen qualvoll sterben, wenn es zum Einsatz von Nuklearwaffen kommt.
Als Gesundheitsfachkräfte muss uns bewusst sein, was die gesundheitlichen Folgen von Krieg sind, auch ohne den Einsatz solcher Waffen. Die Geschichte aber auch ein Blick in aktuelle Kriegsregionen lassen keine Zweifel zu. Es sind nicht nur Schussverletzungen von Soldat*innen, die in Notoperationen versorgt werden müssen. Es sind erblindete, zerfetzte, gefolterte, hungernde, an Infektionen sterbende Kinder, Mütter, Großmütter, Väter. Es sind psychische Traumata, die über Generationen hinweg weitergegeben werden, die eine nicht heilen wollende Wunde tief in der Gesellschaft hinterlassen. Deshalb gilt, was die IPPNW bereits in den 1980er Jahren sagte: Wir werden euch nicht helfen können.
Die Rede von Resilienz ist in diesem Zusammenhang zynisch. Sie verhöhnt nicht nur die vielen Millionen Menschen auf dieser Welt, die bereits jetzt während eines Krieges und unter dessen Folgen leiden, sondern vermittelt auch den Eindruck, als sei Resilienz in einem Krieg etwas Erstrebenswertes. Dass Generationen in unserer Gesellschaft in Frieden aufgewachsen sind, scheint als Schwäche betrachtet zu werden. Das vermitteln zumindest die Klagen des sogenannten Militärexperten Carlo Masala über die geringe Widerstandsfähigkeit der deutschen Gesellschaft.
Der bundesdeutsche Umgang mit Geflüchteten zeugt nicht unbedingt von dem Willen, Kriegsfolgen zu mindern. Bereits jetzt leben Hunderttausende von Krieg und Flucht traumatisierte Menschen in Deutschland, deren psychosoziale Betreuung völlig unzureichend ist. Der Anteil der Geflüchteten, die Foltererfahrungen haben, steigt dabei mit zunehmender Abschottungspolitik der EU weiter an, währen die Mittel zur dringend notwendigen Versorgung dieser Menschen weiter gekürzt werden.
Es ist kein vermeintlich neutrales, humanistisches Handeln, wenn wir unsere Gesundheitsversorgung im Sinne einer zivil-militärischen Zusammenarbeit mit der Bundeswehr verzahnen und unter militärische Kontrolle bringen lassen. Die Interessen von Zivilbevölkerung und Militär sind nicht deckungsgleich.
Aktuell wird aus den Reihen der Bundeswehr gefordert, dass im Kriegsfall Ressourcen aus der zivilen Gesundheitsversorgung frei gemacht werden für die militärische Versorgung, das heißt in erster Linie für die Wiederherstellung der Humanressourcen des Militärs. Dabei geht es etwa darum, Betten für »zivile Zwecke«, das heißt für Menschen mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Schenkelhalsfrakturen, zu sperren, um sie vorsorglich für Soldat*innen frei zu machen, deren massenhafte Verletzungen bereits einkalkuliert sind, etwa, weil sie vorsätzlich in eine geplante Schlacht geschickt werden. Das ist keine »neutrale« Gesundheitsversorgung, sondern aktive Beteiligung am Kriegsgeschehen.
Neue Härte
Und die will geübt sein. Der Generalstabsarzt der Bundeswehr, Johannes Backus, sagte im Dezember 2024 der Süddeutschen Zeitung: »Erfahrung und Wissen von Ärzten, die die Weltkriege erlebt haben, sind über die Jahrzehnte verloren gegangen. Das könnte sich jetzt rächen.« Im selben Artikel beschwert er sich, dass deutsche Unfallchirurg*innen nur mit stumpfen Traumata Erfahrung haben. Das sind Unfallverletzungen durch den Kontakt mit nicht spitzen Gegenständen oder Oberflächen. Da sei man in Ländern mit stärkerem Schusswaffengebrauch wie den USA weiter.
Es gibt sicher nicht nur einige Unfallchirurg*innen, die die angebotenen Fortbildungen und die geforderten Zusatzqualifizierungen sehr anspricht: spritzendes Blut, splitternde Knochen, amputierte Gliedmaßen und Strahlenschutzanzüge. Denn die Bundeswehr spielt mit dem Bedürfnis, etwas Wichtiges zu tun und Held*in zu sein. Das verfängt gerade in einem Gesundheitssystem, dessen Bedeutung in den letzten Jahren immer mehr unter die Maßgaben der Ökonomisierung gestellt wurde. Als Ärzt*in, Rettungssanitäter*in oder Pflegekraft ist es frustrierend und verletzend, die eigene Arbeit den Profitinteressen eines Konzerns unterzuordnen. Damit verliert die Arbeit an und mit Patient*innen ihren besonderen Charakter. Egal, ob erfolgreiche Reanimation, einfühlsames Beruhigen eines Kindes oder Trauerbegleitung von Angehörigen – was am Ende dabei für das Krankenhaus zählt, ist, wie kosteneffizient diese Arbeit verrichtet wurde.
Die zivil-medizinische Zusammenarbeit verheißt, das zu tun, »was wirklich zählt«. Sie spricht Gesundheitsfachkräfte als selbstlose Held*innen an und nicht als Dienstleistende. Für ein höheres Ziel an die eigenen Grenzen zu gehen verspricht, endlich den Ruhm, die Anerkennung und die Sinnstiftung zu erleben, die im Klinikalltag fehlt.
Die Debatte geht gerade nur in Richtung Kriegstüchtigkeit. Sie lässt damit die entscheidende Frage außer Acht: Wie es zu einem Krieg kommen kann, was ihn verhindern würde und wer in einem Krieg gegeneinander kämpft? So viel ist klar: Die Eliten sind es nicht. Würden sich die Ärzt*innen der Bundeswehr unterordnen, wenn Deutschland ein anderes Land angreift? Um was genau geht es in diesem (noch) imaginierten Krieg, welchen Interessen sollen wir uns in den Dienst stellen?
Auch der nächste Arbeitskampf im Krankenhaus, der Einsatz für Patient*innen gegen ökonomische Zwänge und der Kampf für eine friedliche, bessere Gesellschaft kann Sinn stiften. Nicht Kriegsübungen, sondern nur Frieden kann die Menschen vor den grausamen Folgen eines Krieges schützen.