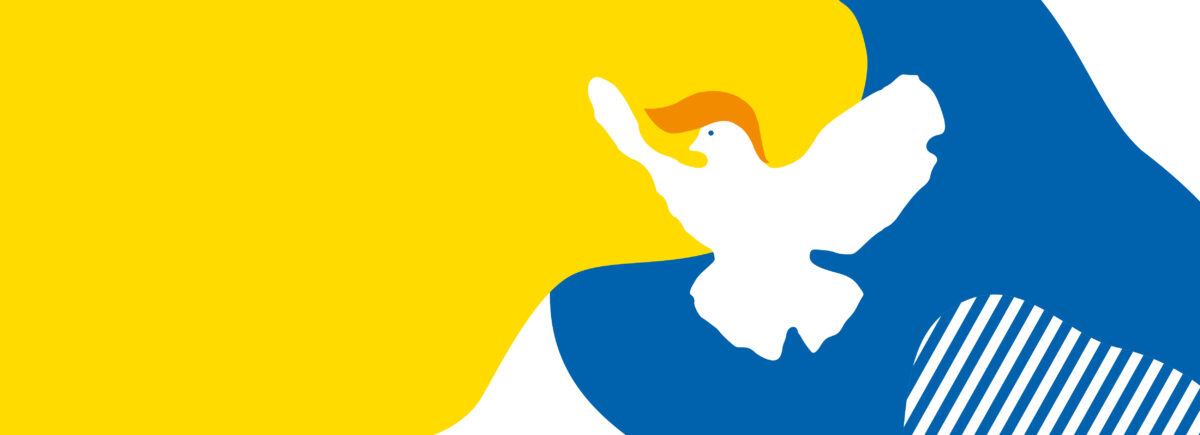Ein Deal für Putin
Der »Friedensplan« von Trump ist aus Sicht der Ukraine eine Katastrophe – und er kündigt ein neues imperialistisches Zeitalter an
Von Anna Jikhareva

Im Wahlkampf hatte er vollmundig versprochen, Russlands Krieg gegen die Ukraine in »nur einem Tag« zu beenden. In den letzten Wochen hatte Donald Trump seine Ansagen allerdings merklich zurückgeschraubt, redete bloß noch von der Hoffnung auf ein Kriegsende in den kommenden sechs Monaten. Dann kam der 12. Februar 2025. Den Krieg beendete der US-Präsident zwar auch an diesem Tag nicht. In die Geschichtsbücher eingehen dürfte das Datum dennoch: als jener Moment, in dem die USA – bisher der wichtigste Unterstützer der Ukraine – eine Kehrtwende in ihrer Politik vollzogen. Der Moment, in dem sich die ersten Konturen einer zukünftigen Ordnung offenbarten, die für das angegriffene Land nur düstere Aussichten bereithält.
Er habe ein »langes und sehr produktives« Gespräch mit Wladimir Putin geführt, verkündete der neue starke Mann in Washington stolz auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Die beiden Staatschefs stimmten überein, »dass wir das millionenfache Sterben stoppen wollen, das im Krieg Russland/Ukraine stattfindet«, erklärte Trump – ganz so, als wäre das Sterben eine Naturgewalt und Russland nicht Urheber des Kriegs.
Als Ergebnis des Telefonats präsentierte der US-Präsident unverzügliche Verhandlungen mit dem Kreml, ohne deren Aufnahme an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Für einen Mann, der stets damit prahlt, die »art of the deal« bestens zu beherrschen, keine Glanzleistung. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij informierte Trump im Anschluss über das Ansinnen, die europäischen Staatsoberhäupter erfuhren sogar erst aus den Medien davon. Den Vorgang auf eine kurze Formel gebracht: Über den Kopf der Ukraine hinweg besiegeln Russland und die USA nun deren Zukunft.
Der Wechselkurs des Rubels schoss nach Trumps Ankündigung in die Höhe, der russische Aktienindex ebenso.
Am selben Tag skizzierte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Brüssel bereits Eckpunkte der anvisierten Ordnung: Ein Nato-Beitritt der Ukraine sei ebenso unrealistisch wie eine Rückkehr zu den – völkerrechtlich anerkannten – Grenzen des Landes vor 2014. Zudem machte Hegseth klar, dass sich die Europäer*innen künftig selbst um die Sicherheit auf dem Kontinent kümmern müssten und auch die Absicherung einer möglichen Waffenstillstandslinie übernehmen sollten, ohne US-Truppen und ohne Beistandsgarantien seitens der Nato. Ihre Militärbudgets sollten die europäischen Staaten ohnehin auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung hochschrauben.
Mit dem nun vorgestellten US-Plan werden schon vor dem Start eventueller Gespräche gleich mehrere von Putins Forderungen erfüllt: Denn Russland beansprucht die Krim sowie die vier offiziell annektierten, aber militärisch nicht vollständig eroberten Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson für sich, verlangt ein Ende der Nato-Beitrittsambitionen der Ukraine sowie ihre weitgehende Entmilitarisierung. Einen Tag später relativierte Hegseth die Äußerungen des Vortags wieder – alles liege auf dem Tisch –, wobei unklar blieb, ob er damit die Zugeständnisse an Russland zurücknahm oder noch mehr Entgegenkommen in Aussicht stellte.
Neue Hebel für den Kreml
So oder so: Im Kreml dürften am 12. Februar die Korken geknallt haben – eine bessere Entwicklung hätte man sich dort kaum ausmalen können. Ganz so wie in den »guten alten Zeiten« der Imperien kann Putin nun auf Augenhöhe mit den USA verhandeln – mit der Ukraine und Europa zu Zuschauer*innen degradiert. Eben noch der Paria, erhält er damit aus Washington den Normalisierungsstempel – und die Öffentlichkeit ein (weiteres) Beispiel dafür, dass militärische Aggression schlussendlich belohnt wird. Das freut im Übrigen auch das Kapital: Der Wechselkurs des Rubels schoss nach Trumps Ankündigung ebenso in die Höhe wie der russische Aktienindex.
Stattfinden sollen die Gespräche zwischen Russland und den USA wohl »in naher Zukunft« in Saudi-Arabien. Welche Fragen dabei diskutiert werden, ist derzeit unklar – und ein konziser Plan vonseiten der USA nicht erkennbar. Das zeigt sich schon daran, dass Trumps Ukraine-Sondergesandter, der pensionierte General Keith Kellogg, gar nicht Teil der Delegation sein soll. Kellogg war in den letzten Wochen an zahlreichen Gesprächen mit Vertreter*innen anderer Staaten beteiligt und hatte auch die bisher vermutete neue US-Linie vertreten: Druck auf Russland durch Sanktionen und weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, falls Putin nicht zu Verhandlungen bereit wäre. Stattdessen werden wohl unter anderem Außenminister Marco Rubio, CIA-Chef John Ratcliffe sowie der Nahostgesandte Steve Witkoff bei den Gesprächen am Tisch sitzen. Weitere Details könnten im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt werden, die allerdings nach Redaktionsschluss dieser ak-Ausgabe stattfindet.
Thema in München ist auch die Rolle Europas, das von Trumps Ankündigung mehr als überrumpelt ist und bisher keine kohärente Antwort findet. Denn sollten die Verhandlungen tatsächlich zu einem Waffenstillstand führen, was offen ist, müsste dieser auch gesichert werden. Sonst wird Russlands Drohung im Raum stehen bleiben, nach einer Verschnaufpause seinen Angriffskrieg fortzusetzen. So erhält der Kreml einen starken Hebel, den künftigen ukrainischen Rumpfstaat auch in Zukunft indirekt zu kontrollieren und destabilisieren zu können.
Dass Putin sich allein mit den annektierten Gebieten und dem Nato-Aus »zufriedengibt«, dagegen spricht ein Satz aus der Pressemitteilung zum Trump-Telefonat, der in der Berichterstattung bisher kaum Beachtung fand: Demnach habe Putin betont, »dass die ursprünglichen Ursachen des Konflikts beseitigt werden müssen«. Und diese Ursache ist aus Sicht des Kremls die Existenz eines unabhängigen ukrainischen Staates. Möglich auch, dass Verhandlungen für Putin lediglich ein Zeitspiel sind, da der Krieg es ihm trotz einiger Rückschläge erlaubt hat, seinen Herrschaftsgriff im Innern zu festigen und jede Opposition zu neutralisieren. In jedem Fall ist zu erwarten, dass Russland in den kommenden Wochen den militärischen Druck auf die Ukraine weiter erhöhen wird: Sollte die Front dann irgendwann mit einem Waffenstillstand eingefroren werden, wird es mehr Territorium annektiert haben, so das Kalkül.
Entsetzen in Europa
Nun, da sich die USA offiziell vom »alten Kontinent« abwenden, fordern manche, Europa solle das für die Ukraine verheerende Szenario abwenden, indem es die wegfallende US-Hilfen kompensiert und so sich und der Ukraine einen Platz am Verhandlungstisch erstreitet. Doch selbst, wenn sich die politisch uneinigen europäischen Staaten zu einer solchen Linie durchringen sollten, wären sie ohne die USA militärisch nicht stark genug, um Russland von einem erneuten Überfall auf die Ukraine abzuhalten, wie selbst der britische Geheimdienst MI6 zu bedenken gibt.
Überlegungen, wie Europa die Souveränität der Ukraine sichern kann, laufen in einzelnen Nato-Staaten zwar seit Längerem, darunter in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Diskutiert wird etwa eine »Friedenstruppe«, die eine entmilitarisierte Zone zwischen der Ukraine und Russland (inklusive der besetzten Gebiete) überwachen würde. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprach Wolodymyr Selenskij im Januar allerdings von »mindestens 200.000«, später von 100.000 bis 150.000 Soldat*innen, die für die Sicherung der mehrere tausend Kilometer langen Grenze nötigt würden – für europäische Länder allein eine gänzlich unrealistische Zahl. Wie etwa die Brics-Staaten, die ebenfalls Truppen stellen könnten, auf die Vorschläge blicken, ist bisher unklar.
Die Ukraine selbst hat in diesen entscheidenden Tagen praktisch nichts mitzureden, auch wenn Selenskij betont, es dürfe keine Gespräche ohne Beteiligung Kiews geben. Vielen im Land war zwar auch vor dem Telefonat vom 12. Februar klar, dass die von Russland annektierten Gebiete (zumindest vorerst) verloren sind – und eine Nato-Mitgliedschaft ohnehin nicht wirklich zur Debatte stand, weil auch Trumps Vorgänger Joe Biden nicht an der Aufnahme eines Landes im Krieg interessiert war. So wie es derzeit aussieht, könnte die Ukraine Aggressionen des Nachbars künftig mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert sein. In Europa wiederum wird die US-Initiative vermutlich eine hektische Aufrüstungsdebatte lostreten und bereits bestehende Konflikte über den außenpolitischen Kurs der EU-Staaten verschärfen. Die neue internationale Ordnung, die sich dieser Tage abzeichnet, ist entsprechend keine friedlichere, sondern eine, in der die neoimperialistischen Rivalitäten noch schneller in neuen Kriegen eskalieren können.